Wenn die nötigen regulatorischen Rahmenbedingungen gegeben sind, könnte die installierte Kapazität von Großbatteriespeichern Deutschland bis 2030 gegenüber heute um den Faktor 40 auf 57 Gigawattstunden steigen, bei 15 Gigawatt Gesamtleistung. Das zeigt eine Studie, die die Unternehmen Baywa re, Eco Stor, Enspired, Fluence und Kyon Energy beim Analystenhaus Frontier Economics in Auftrag gegeben haben.
Bis 2050 könne der Bestand an Großspeichern in Deutschland auf bis zu 60 Gigawatt beziehungsweise 271 Gigawattstunden steigen. Der Zubau werde durch die wachsende Nachfrage nach Flexibilität im Stromsystem sowie fallende Kosten für die Anlagen getrieben.
Eingesparte Brennstoff- und CO2-Kosten schaffen volkswirtschaftlichen Mehrwert
Aus der Studie geht auch hervor, dass Großspeicher durch die Verschiebung der Verfügbarkeit von Strom aus Zeiten mit Stromüberschuss in Zeiten mit einem Strommangel einen erheblichen volkswirtschaftlichen Mehrwert schaffen können. Frontier Economics beziffert allein die Einsparungen am Großhandelsmarkt auf etwa zwölf Milliarden Euro bis 2050 – ohne den zusätzlichen Nutzen für Systemdienstleistungen, die Vermarktung am Intradaymarkt oder weitere volkswirtschaftliche Folgeeffekte zu berücksichtigen.
Ein wesentlicher Grund dafür liege in den eingesparten Brennstoff- und CO2-Kosten. So helfen der Studie zufolge Großbatteriespeicher im Jahr 2030, rund 6,2 Millionen Tonnen CO2 und 2040 rund 7,9 Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden. Das zeigt die Vergleichsrechnung mit einem Stromsystem, in dem in Deutschland statt Großbatteriespeichern überwiegend Gaskraftwerke eingesetzt werden.
Zudem macht die Studie deutlich, dass die Speicher eine senkende Wirkung auf die Großhandelspreise haben: Sie reduzieren den Preis zwischen 2030 und 2050 im Durchschnitt um circa 1 Euro pro Megawattstunde. Wenn keine Möglichkeit besteht, stationäre Batteriespeicher durch zusätzliche Gaskraftwerke zu ersetzen, wäre im Durchschnitt von 2030 bis 2050 sogar mit einem um vier Euro pro Megawattstunde höheren Großhandelspreis zu rechnen, so Frontier Economics.
Auftraggeber sehen Politik gefordert
Der Ausbau von Großbatteriespeichern könne darüber hinaus wesentlich dazu beitragen, den Investitionsdruck bei Gaskraftwerken zu reduzieren. In einem Szenario ohne Speicherausbau reichten die geplanten rund 26 Gigawatt Leistung neuer Gaskraftwerke bis 2030 nicht aus – es müssten weitere 9 Gigawatt zugebaut werden. Die Modellierung der Studie zeigt, dass Großspeicher den Zubau zwar nicht vollständig ersetzen, aber wesentlich dazu beitragen können, den Investitionsdruck bei neuen Gaskraftwerken bis 2030 zu reduzieren.
Die Auftraggeber der Studie sehen die Politik gefordert, für Investitionssicherheit beim Bau von Großbatteriespeichern zu sorgen. Bürokratische Hemmnisse und regulatorische Barrieren beispielsweise bei den Genehmigungsverfahren müssten abgebaut werden. Alle Märkte für Energie, Kapazität und Systemdienstleistungen in Deutschland sollten technologieoffen und marktbasiert ausgestaltet sein. Die Bundesregierung müsse schnellstmöglich die Vorgaben aus der aktuellen Reform des europäischen Strommarktes zur Festlegung indikativer Speicherziele umsetzen.
Darauf aufbauend sollte die Bundesregierung eine Ausbaustrategie für Großbatteriespeicher in Deutschland vorlegen. Mit der kürzlichen Veröffentlichung der Stromspeicher-Strategie hat die Bundesregierung in den Augen der Auftraggeber der Studie einen ersten Schritt gemacht, der jetzt zeitnah in konkrete Gesetzgebungsvorhaben zu überführen sei.
„Großbatteriespeicher spielen für die Energiewende zentrale Rolle“
Christoph Gatzen, Direktor bei Frontier Economics, sieht in der Studie eine Bestätigung der zukünftigen Rolle von Großbatteriespeichern in Deutschland: „Die Ergebnisse zeigen ganz klar, dass Großbatteriespeicher für die Energiewende in Deutschland eine zentrale Rolle spielen. Ein Verzicht auf diese flexibel einsetzbare Technologie führt zu höheren Gasimporten und mehr Abregelung erneuerbarer Energien in Deutschland und damit zu höheren volkswirtschaftlichen Kosten.”
Sowohl bezüglich der Kostendegression als auch der Zubaurate versprächen Batteriespeicher eine ähnlich dynamische Entwicklung wie Photovoltaikanlagen in den vergangenen Jahren – mit dem Unterschied, dass Großbatteriespeicher ohne staatliche Förderung und rein marktgetrieben zugebaut und wirtschaftlich betrieben werden können.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.





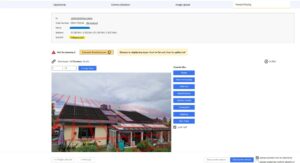


Batteriespeicher und andere Kurz- und Langzeitspeicher könnten neben dem Ersatz von Spitzen Gaskraftwerken auch das Stromnetz insgesamt besser auslasten (Nord-Süd Link) und dadurch die Investitionskosten für Leitugen und Abregelung senken.
Im Prinzip bin ich der gleichen Meinung und sehe viele volkwirtschaftliche Vorteile, wenn man Sonne und Wind in größeren Speichereinheiten puffern könnte. Zusätzlich sehe ich auch noch die Möglichkeit, durch geschicktes Anordnen von Speichern den Netzausbau zu reduzieren und durch noch geschickteres Anordnen die Abwärme alle Prozesse rund um das Puffern für die Wärmewende zu nutzen. Damit das gut wird, lautet mein Vorschlag: Speichern auf allen Netzebenen in die Regie der Netzbetreiber zu geben, denn die wissen am besten, was netzdienlich ist. Wegen der systemisch wichtiger werdenden Vernetzung aller Netze (Strom, Gas, Wärme, Kälte) wäre es auch geboten, alle Netze in einer Hand (die öffentliche?) zu bündeln und einen Gesamtnetzentwicklungsplan incl. Speicherung und Abwärmenutzung im Rahmen einer dezentral-zellularen Energieversorgung zu haben. Dazu habe ich schon sehr deutliche Worte gefunden, welche ich gerne hier wiederhole:
Bitte die Netzbetreiber aller Energieformen und auf allen Ebenen vergesellschaften und einen einzigen Neztentwicklungsplan für alle Energieformen incl. Speicher entwickeln, damit der Netz- und Speicher-Ausbau gemeinwohlorientiert vonstatten geht und die Abwärme aus den kommenden Netzspeichern intelligent und effizient mitgenutzt werden kann. Die Königsdisziplin der Energiewende wird die Abwärmenutzung werden.
Zusatz: Es wird vermutlich 170 Terawattstunden Langfristspeicher bedürfen, um 100 % EE-Versorgung in Deutschland mit Wind- und Solarkraft hinzubekommen. Damit wären dann 100 % Autarkie und bilanzielle Autonomie möglich. Die Pläne der Bundesregierung sind in meinen Augen völlig unterambitioniert und gehören auf den Prüfstand.
Im übrigen gilt das natürlich auch noch immer:
https://www.pv-magazine.de/2023/01/24/energiewende-ja-aber-wie/
Prinzipiell ist ihr Vorschlag sicher richtig. Aber woher soll der Staat das ganze Geld nehmen für die notwendigen Investitionen? Steuern erhöhen? Subventionen streichen? Investitionen tätigen mit Krediten gegen die Schuldenbremse?
Ohne Investitionen aus dem Privatsektor wird die nötige Investitionssumme nicht zusammen kommen, denke ich.
@RGS: Prinzipiell bezahlen alle Verbraucher Netzgebühren für einen auskömmlichen Betrieb der Netze. Genau das wünsche mich mir auch weiterhin für den Betrieb des einen Supergrids. Speicher könnten in privatem Besitz bleiben/sein, wenn sie unter der Regie des Netzbetreibers sind. Der Netzbetreiber schreibt also aus, wo er welche Speicher haben möchte und garantiert dem Speicherinvestor eine auskömmliche Rendite. Also im Prinzip das gleiche, wie mit Wind- und Solaranlagen. Da garantiert das EEG dem Investor eine auskömmliche Rendite für einen 20 jährigen Zeitraum und dann geht es eventuell mit auskömmlichen PPA-Verträgen für den Investor weiter. Das sollte ohne Schuldenbremsmechanismen funktionieren können. Wobei ich kein Problem damit hätte, für die Netzinfrastruktur samt Speicher und Abwärmenutzung die Schuldenbremse großzügig zu umschiffen, um solche Investitionen in die Zukunft zu auch staatlich finanzieren zu können. Privat oder Staat ist ja eigentlich dasselbe, denn wir sind der Staat, oder?
@Ralf Schnitzler das ist aber keine Investition für die Zukunft. Die Lebenserwartung ist abhängig von dem Gras der Nutzung und auch nur erforderlich weil man die volatilen EE nicht steuern kann. Selbst mit diesen Speichern muss man für jede installierte Leistung an EE ein schnelles und garantiert verfügbares Backup zur Verfügung haben. Oder aber einen Plan wie man das Netz rotierend abschaltet. Es stellt sich doch die grundlegende Frage wer das alles bezahlen soll. Für WEA und PV finden sich bei den aktuellen Zinssätzen keine Investoren, gesudiwenig wie für Hydrolyseure und Batteriespeicher. Und wenn irgendwo was geplant ist geht’s nur über Subventionen. Rechnet man um, um wieviel sich der Strom verteurt muss man wirklich hoffen, dass un und drumherum AKW gebaut werden, die helfen unseren energiepolitschen Schwachsinn zu kaschieren. Es nützt doch nichts, perfekte Prozesse zu beschreiben die niemals umgesetzt werden. Es fehlt eine klare Zieldefinition. Wir machen einfach in der Hoffnung, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Wenn ich mir diesen ahnungsarmen Habeck anhören, der noch nicht einmal halbwegs ruckelfrei das Gescheurbel deiner Redenschreiber raushauen kann, seh ich den Wirtschaftsstandort Deutschland mehr als gefährdet.
Mein Lieber Engelbert.Montagne, sie haben offenbar die besseren Antworten, die sie bitte ausführlicher ausbreiten mögen, dann folge ich Ihnen gerne, falls ich diese nachvollziehen kann. Ansonsten finde ich meine Pläne klüger Wind und Sonne zu speicher (Kurz-mittel-langfristig), um jede Dunkelflaute zu überstehen. Wenn man alle Energienetze systemisch zusammen bringt und die Speicherung/Enspeicherung mit einer Abwärmenutzung kombiniert, ist das effizienter und unter dem Strich vermutlich preiswerter als das, was Sie andeuten. Atomkraft als Ausweg scheint mir auf jeden Fall eine Technologie zu sein, die überhaupt nicht zielführend mit Wind- und Sonne kombiniert werden kann.
Bin gespannt, was Sie für gute Argumente bringen.
Zitat Ralf Schnitzler: „Es wird vermutlich 170 Terawattstunden Langfristspeicher bedürfen, um 100 % EE-Versorgung in Deutschland mit Wind- und Solarkraft hinzubekommen.“
Interessant. Das sind etwa 10 % des Jahresenergiebedarfs. Diese Größenordnung hat schon 2010 Matthias Popp in seinem Buch festgestellt.
https://www.buecher.de/shop/energietechnik/speicherbedarf-bei-einer-stromversorgung-mit-erneuerbaren-energien/popp-matthias/products_products/detail/prod_id/26903333/
Danke für den Hinweis auf das Buch von Matthias Popp.
Der Kurzstudie mangelt es an Aussagekraft. Der Grund: Verengter Blick auf Großbatteriespeicher, ohne ausreichende Berücksichtigung der Wechselwirkungen mit den übrigen Komponenten des künftigen Energiesystems, wie zum Beispiel Gaskraftwerke. Die Feststellung in der Kurzstudie Seite 6:
„…Großbatteriespeicher…können .. den Einsatz von fossilen Gaskraftwerken reduzieren.“ Im Prinzip ja. Die Frage ist aber, inwieweit dies sinnvoll sein würde.
Hintergrund: In einer klimaneutralen Energieversorgung größtenteils mit Wind- und Solarstrom müssen Mangelphasen nicht nur über Stunden, sondern auch über Tage und Wochen ausgeglichen werden. Die aus Kosten- und Materialgründen begrenzte Kapazität der Batteriespeicher wird auch bei starkem Zubau bereits nach Stunden erschöpft sein. Folglich muss die Leistung der Gaskraftwerke zur Deckung der gesamten Verbrauchslast ausgelegt werden (siehe Kurzstudie, Abbildung 4). Jede Gigawattstunde erhöhte Batteriekapazität würde aber bewirken, dass die Laufzeit der vorzuhaltenden Gaskraftwerke abnimmt. Das heißt, jede zusätzliche Investition in kostspielige Batterien würde zu unwirtschaftlicherem Betrieb der Gaskraftwerke führen. Damit würde der Fluktuationsausgleich von beiden Enden her verteuert.
hsk schreibt: „aus Kosten- und Materialgründen begrenzte Kapazität der Batteriespeicher wird auch bei starkem Zubau bereits nach Stunden erschöpft sein.“ Das sehe ich anders. Wenn es genug Batteriespeicher gäbe, könnten die monatelang Energie liefern. Es geht mir aber nicht nur um Batteriespeicher, sondern um Energiespeicher aller Art – sogar solche, die es noch gar nicht gibt. Da dürfte noch viel Luft nach oben sein, wenn der Business-Case endlich da wäre, was Forschung und Fortschritt betrifft. Darüber hinaus geht es mir immer um die Wärmewende mit der Abwärmenutzung aus den kommenden Speichern. Das ist die Königsdisziplin der Energiewende und die macht die Speicher effizient und preiswert. Solange man den systemischen Zusammenhang mit Abwärmenutzung nicht berücksichtigt, ist Speichern vermutlich wirklich unattraktiv gegenüber einem Reservekraftwerkspark. Nur will ich den genau nicht haben, weil das ein Beibehalten der alten Energiewelt wäre und ein völliger Anachronismus, den wir uns hoffentlich nicht leisten. Bin gespannt, wie das in anderen Ländern der Welt gelöst wird! 🙂 Vielleicht schauen wir öfter nach Dänemark, um zu sehen, wie das geht!
@Ralf Schnitzler
Danke für den Hinweis auf die Integration der Energienetze. Darüber muss ich mich noch mehr informieren. Dazu müssten dann auch Kältenetze gehören. In München wird schon länger am Kältenetz gebaut wie man seit Jahren an den vielen Baustellen in den Straßen sehen kann.