Die Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH (VBB) und Renewable Energy Systems (RES) melden die planmäßige Fertigstellung eines Lithium-Ionen-Batteriespeichers mit zehn Megawatt Leistung und 15 Megawattstunden Kapazität. Der Speicher ist demnach sowohl inselnetzfähig als auch schwarzstartfähig. Das bedeute, dass bei einem Netzausfall das lokale Netz in Bordesholm als Inselnetz weiterbetrieben werden könne. Außerdem sei der Batteriespeicher in der Lage, ein abgeschaltetes Stromnetz neu aufzubauen, was bislang fossilen Kraftwerken vorbehalten gewesen sei. Inselnetz- und Schwarzstartfähigkeit des Batteriespeichers wurden laut RES unter anderem in einem Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Köln unter Beweis gestellt. Zudem soll der Großspeicher Schwankungen im Netz ausgleichen und Primärregelenergie bereitstellen.
„Die zukünftig dezentrale Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien bietet uns nun die einmalige Möglichkeit zum Aufbau eines zellulären Netzes aus vielen kleinen autarkiefähigen Stromnetzen, ähnlich einer Bienenwabenstruktur, die gemeinsam einen Netzverbund ergeben, aber auch eigenständig eine Region sicher versorgen können“, sagte VBB-Geschäftsführer Frank Günther. Die erste Zelle dieser geplanten ‚Bienenwabenstruktur‘ sei Bordesholm. Die Kommune deckt bereits etwa 75 Prozent ihres jährlichen Strombedarfs aus erneuerbaren Energien.

Foto: RES Deutschland
Der Batteriespeicher wurde auf dem Firmengelände von VBB errichtet, mit dem Bau wurde im Sommer 2018 begonnen. Wie RES nach dem Gewinn der Ausschreibung mitteilte, soll der Speicher durch die Bereitstellung von Primärregelenergie Jahreserlöse von rund einer Million Euro einbringen. Für RES ist es Presseunterlagen zufolge das erste Multi-Megawatt-Projekt in Deutschland. Zuvor habe das Unternehmen verschiedene Batteriespeicherprojekte für Netzdienstleistungen in Großbritannien, den USA und Kanada umgesetzt.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.





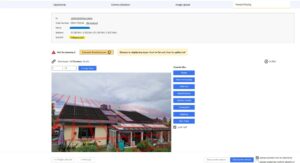


So sehr es mich freut, dass auch weiter MW Speicheranlagen installiert werden, darf ich doch darauf hinweisen, dass die Fa. Younicos AG Berlin bereits 2012 eine 5 MW LiOnen Speicheranlage bei der WEMAG in Schwerin mit genau den hier beschriebenen Eigenschaften installiert hat und damit die Reste Multi MW Anlage in Deutschland war und auch TERNA in Italien bereits mehre MW Speicher sowohl mit LiOnen als auch mit Natrium Schwefel Batterien mit genau diesen Aufgaben seit Jahren in Betrieb hat. Die Aussage die erste Multi MW Anlage geliefert zu haben ist ganz einfach falsch.
Im Text steht, dass es für RES das erste Multi-Megawatt-Projekt in Deutschland ist – nicht das erste im Land überhaupt.
Guten Tag,
Ihnen ist in dem Artikel über den Batteriespeicher in Bordesholm ein kleiner redaktioneller Fehler unterlaufen. Die Aussage, es sei der erste Multimegawatt-Speicher Deutschlands, ist nicht korrekt. Ihr Magazin hatte am 31.5.18 einen Artikel zu dem größten Speicher Europas in Jardelund (48 MW) verfasst.
Im Text steht, dass es für RES das erste Multi-Megawatt-Projekt in Deutschland ist – nicht das erste im Land überhaupt.
Die 15 Megawattstunden Speicherkapazität , die man dem verlinkten Beitrag entnehmen kann, sind nicht sonderlich viel.. Zum Vergleich der größte deutsche Pumpspeicher das Pumpspeicherwerk Goldisthal im Thüringer Schiefergebirge am Oberlauf der Schwarza hat eine Kapazität von 8480 MWh.
Sie vergleichen Äpfel mit Orangen. Es ist, als würde man ein Solarkraftwerk mit einem Kernkraftwerk vergleichen!
Goldisthal ist aber auch etwas größer, als das Gebäude, das man auf dem Photo sehen kann. Da die notwendigen Höhendifferenzen in Deutschland räumlich ungleich verteilt sind, entsteht durch Pumpspeicher ein erheblicher Durchleitungsbedarf für die Be- und Entladung. Pumpspeicher sind trotzdem eine schöne Sache, aber das Potential ist in Deutschland leider begrenzt. Batteriespeicher hingegen kann man dort errichten, wo sie dem Netz dienen und Netzausbaubedarf reduzieren. Außerdem stößt ihr Bau (der sogar unterirdisch möglich wäre) auf weniger Widerstände als Stromleitungen oder Pumpspeicherwerke. 15MWh als Einzelprojekt sind natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn erstmal die ausrangierten PKW-Akkus kommen, dann ist die Speicherkapazität aller Pumpspeicher ganz schnell um ein mehrfaches überschritten. Und die hier beschriebene Betriebsweise, bei der eine weitgehend autarke Netzzelle entsteht, ist genau das, was als Benefit der Dezentralisierung erhofft wird. Vorrangig geht es jetzt erstmal darum, dass solche kleinen Zellen im großen Netz sinnvoll betrieben werden, damit sie dort Kosten sparen und nicht erzeugen. Diese Steuerung ist unter den sich verändernden Bedingungen und der gestiegenen Komplexität im Netz nicht trivial.
Die Komplexität wäre schon immer vorhanden gewesen (im Maßstab der Erdgeschichte gemessen), nur wurde die differenzierte Ausarbeitung der Zusammenhänge durch gesellschaftsweite Grundlagenforschung weniger zukunftsorientieren Prioritäten untergeordnet.
Bezogen auf die Komplexität der Stromversorgung, ohne die stabile Situation von Grundlastkraftwerken und Grundlastverbrauch, ja.
Power-to-Gas könnte sich langfristig an dieses Grundlastszenario wieder annähern, dann aber CO2-vermeidend.