Der Hersteller von Wasserstoffspeicher-Systemen für Einfamilienhäuser, Home Power Solutions (HPS), hat seine Produktpalette um einen Wasserstoff-Stromspeicher für Gewerbeimmobilien oder Mehrfamilienhäuser erweitert. Genaugenommen handelt es sich bei dem neuen Produkt um die Steuerungs- und Energiemanagementeinheit „Förster“, mit der es möglich sein soll, bis zu zehn Wasserstoff-basierte Speichersysteme des Typs „Picea“ von HPS zusammenzuschalten. So ließe sich eine kumulierte elektrische Speicherkapazität von 15.000 Kilowattstunden erreichen.
Das System „Picea“ von HPS speichert überschüssigen Strom von der hauseigenen Photovoltaik-Anlage in Form von grünem Wasserstoff ein. Neben dem Elektrolyseur und der Brennstoffzelle besteht das System auch aus einer 20-Kilowattstunden-Batterie für die Kurzzeitspeicherung. Bei der Rückwandlung wird, sofern nötig, auch die Abwärme genutzt. So könne das System nicht die Stromversorgung ganzjährig abdecken, sondern auch noch die Heizkosten senken, so der Hersteller.
Die Entwicklung der Steuerungseinheit „Förster“ eröffnet nicht nur neuen Kunden die Möglichkeit, sich ganzjährig mit Solarstrom vom eigenen Dach zu versorgen, sondern erlaubt es auch dem Hersteller zukünftig besser von Skaleneffekten bei der Produktion der Speichersysteme zu profitieren. Da sich die Systeme einfach kaskadieren lassen, können die verschiedenen Kundenansprüche durch die Verschaltung identischer Systeme miteinander erreicht werden. So können die Herstellungsprozesse vereinheitlicht werden.
„Mit Multi-Picea haben wir auf die große Nachfrage reagiert und eine Lösung entwickelt, die höhere Speicherkapazitäten und Leistungen im Gebäudebereich bietet“, sagt HPS-Mitgründer und Geschäftsführer Zeyad Abul-Ellla. „In Gewerbeimmobilien und Mehrfamilienhäusern sind die Verbraucher damit in der Lage, ihren Solarstrom mittels einer flexiblen Skalierung unseres erprobten Ganzjahresstromspeichers auch im Winter vollständig zu nutzen. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors.“

Foto: Home Power Solutions
Der Name für das Energiemanagementsystem „Förster“ leitet sich vom Namen des Speichersystems her. Picea ist der lateinische Begriff für Fichte und ein Picea-System spart drei Tonnen CO2 im Jahr oder so viel wie 130 Fichten. Da der „Förster“ bis zu zehn Picea gleichzeitig steuern kann, kümmert er sich sozusagen gleich um einen ganzen Wald.
Das erste System „Förster“ ist auch schon in Betrieb. Der Sitz des Unternehmens Josef Küpper Söhne GmbH aus Meckenheim bei Bonn sei die bundesweit erste Gewerbeimmobilie, die mit dem kaskadierten Wasserstoffspeicher versorgt wird. Der Strom dafür kommt von einer 98-Kilowatt-Photovoltaik-Anlage, die sowohl auf dem Dach als auch an der Fassade des Gebäudes befindet. „Wir verfolgen eine unabhängige und saubere Energieversorgung für unsere Kunden und uns, denn die Zeit ist reif für den Einstieg in eine CO2-freie Gesellschaft“, sagt Josef Küpper Söhne Geschäftsführer, Peter Küpper. „Daher haben wir uns beim Entwurf des neuen Firmenstandorts in Meckenheim für den Langzeitspeicher Multi-Picea von HPS entschieden.“
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.






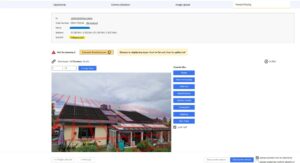


Kann bitte mal jemand die notwendige PV Grösse in Relation zum tatsächlichen Heizwärmebedarf setzen, incl aller Umsetzungsverluste Strom nach H2 in Flasche, zurück mit Brennstoffzelle macht Wirkungsgrad x%, damit der Häuslebauer abschätzen kann, ob das etwas für ihn ist?
Also kWp zu kWh, natürlich hängt das von der Ausrichtung der PV ab etc.
Ich beschäftige mich schon länger mit der saisonalen Energiespeicherung für den Hausgebrauch. Wasserstoff ist schon sehr früh ausgeschieden wegen der Transformationsverluste. Die Abwärme kann ich nicht nutzen. Zwischen Anfang November und Ende Februar kann man den PV Beitrag zur Heiz-und Warmwasserenergie vergessen. Entweder mam speichert Wärme in Form von Wasser, aber dann bräuchte ich ca 50 m3 für die Winterperiode. Es gab einen Anbieter in Süddeutschland, der aber die Produktion eingestellt hat. Nun recherchiere ich die Redox Flow Technologie, also Speicherung von Strom. In meinem Fall benötige ich vermutlich ca. 1,5 MWh, um über den Winter zu kommen. Kann ich locker im Sommer laden. Ist aber sehr wahrscheinlich zu teuer. Also warte ich ab. Zur Berechnung: mit Wärmepumpe brauche ich pro Tag bei Aussentemperaturen um die Null Grad ca. 30 KWh. Bei 120 Tagen macht das 3,6 MWh. Demgegenüber lag die Leistung meiner PV Anlage mit 17,7 KWp in den 4 Wintermonaten Nov -Feb 2020/21 bei 1700 KWh, und der Hausverbrauch in dieser Zeit 3100 KWh. Die Differenz gilt es zu überbrücken.
Die Rechnung ist tatsächlich nicht einfach. Wirtschaftlich wird es nicht, aber das war nicht die Frage. Die PV Anlage sollte 50% der Jahresheizenergie direkt erbringen und die restlichen 50% für die 3 Wintermonate in H2 speichern. Für H2 benötigt man etwa die dreifache Menge an PV Strom wegen der zwei Wandlungen. Angenommen, man hat einen WP COP von 4 und braucht 20.000 kWh Heizwärme ohne WW. Dann sind das 5.000 kWh elektrisch. Davon werden 2.500 kWh in 9 Monnaten direkt solar erzeugt. Für die restlichen 2.500 kWh benötigt man ca. 7.500 kWh vom Dach, in Summe also 10.000 kWh Solarstrom. Bei optimaler Ausrichtung entspricht das 10 kWp. Das Warmwasser macht man mit der Abwärme. Das ist ein grober Überschlag und betrifft nur den Heizstrom. Ich habe nichts mit HPS zu tun, finde es aber cool.
Sorry, aber hier wird das Wesentliche unterschlagen. Kann Wasserstoff das Speicherproblem in einem Haus, versorgt mit einer PV-Anlage, lösen? Ganz klar NEIN! Wieso?
Der Wirkungsgrad auf dem Weg von PV > Elektrolyse > Wasserstoff > Speicherung > Brennstoffzelle > Elektrizität ist schlicht miserabel. Es gehen ca. 80 % der Energie verloren, denn der Wirkungsgrad multipliziert sich mit jeder Umwandlung. Das Bedeutet, dass für jede Kilowattstunde die aus der Steckdose kommen soll, 5 Kilowattstunden von der PV-Anlage eingespeist werden müssen. Eine solche Bilanz kann sich ein Hausbesitzer mit PV-Anlage schlicht nicht und niemals leisten. Kommt hinzu, dass die PV-Anlage auf dem Hausdach über mehr als 4 Monate (Winter) praktisch keine Energie liefert.
Wenn wir den unglaublichen Überschuss den Windkraftanlagen zu gewissen Zeiten produzieren nutzen wollen, so ist das eine andere Sache. Hier kommt dann noch der anspruchsvolle Transport und die Lagerung des H2- Molekül hinzu, das unglaublich klein ist und sich durch jeden Behälter lieblich gerne ins Freie absetzt, wo sich dann im Zusammenhang mit Luft das gefürchtete Knallgas bildet. Also auch in diesem Fall ist es aus ökologischer und ökonomischer Sicht ein mörderisches Unterfangen zu einem höllischen Preis!
Grüsse aus der Schweiz
Jürg Schneeberger
Dipl. Ing. Flugzeugbau & Linienpilot i.R.
Die Polemik am Ende („mörderisch“) ist nicht angebracht. Es gibt wasserstoffdichte Behälter und Leitungen. Die normalen Gasleitungen sind allerdings normalerweise nicht wasserstoffdicht, weshalb man auch nicht einfach Erdgas durch Wasserstoff ersetzen kann. Man muss dann auch neue Gasleitungen legen. Ansonsten stimmt es: Es ist sehr teuer, und der schlechte Wirkungsgrad verhindert eine 100%-Autarkie im Einfamilienhaus. Eine Lösung für die Breite ist die kleinteilige Wasserstoffproduktion und -speicherung also nicht. Im großen Maßstab wird sie das natürlich sein, weil Elektrolyseure netzdienlich betrieben die häufige Strom-Überproduktion aufnehmen werden, und der Wasserstoff, in KWK-Anlagen verwertet, die Dunkelflaute kompensieren muss. Einzige bisher absehbare Konkurrenz könnten Hochtemperaturspeicher werden. Die könnten einen etwas besseren Wirkungsgrad haben und sind dabei ziemlich Low-Tech.
Für den reichen Privatmann gilt: Man kann sein überflüssiges Geld schlechter ausgeben, als für so ein System. Man sollte aber genau nachrechnen, ob es nicht noch bessere Möglichkeiten gibt. Beispielsweise eine große PV-thermische Anlage, die einen Teil der sommerlichen Wärme in einen großen Wärmespeicher einlagert. Das Problem, dass man im Winter zu geringe Stromerträge hat, um selbst den Haushalts- und Mobilitätsbedarf zu decken, sehe ich nicht so kritisch: Das Netz freut sich, wenn man die hohen Windstromüberschüsse reduziert.
Wenn man dann immer noch Geld über hat, sollte man das in Bürgerenergiegenossenschaften oder Crowdfundingprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern investieren. Dort herrscht Kapitalmangel, der verhindert, dass alte, teure fossile Anlagen durch moderne regenerative ersetzt werden.
Lieber Herr Schneeberger,
Ihr Kommentar ist nicht nur nicht hilfreich sondern von vorn bis hinten falsch. Es ist sehr schade, wenn sich gebildete Leute wie sie dazu hinreißen lassen, derartig krasse Fake News in die Welt zu setzen, nur weil sie keine Lust haben, Fakten zu recherchieren. Hoffentlich glaubt keiner blind ihren Ausführungen sondern informiert sich direkt in den FAQ bei HPS.
Wünsche angenehmen Flug.
Der Wirkungsgrad auf dem Weg von PV > Elektrolyse > Wasserstoff > Speicherung > Brennstoffzelle > Elektrizität ist schlicht miserabel.
Dies trifft bei Netz-gebundenen H2-Anlagen zu!!! Jedoch bei Inselanlagen durch Abwärmenutzung ist Ihre Aussage fehlerhaft.
Pzu bei 100Kwh PV x η 97% AC>DC entfällt, da PV DC liefert; somit 100 Kwh x η 74% Elektrolyse u. η 97% Verdichtung ist 71 Kwh H2. Die 26% „Verluste“ vom Elektrolyseur bleiben für die Warmwasserbereitung und unberücksichtigt.
Brennstoffzelle Pzu 71 Kwh x η 50% x η 97% DC>AC ist 35 Kwh elekt. plus 35 Kwh thermisch für Nutzung der Heizung und WW, somit ein gesamt η 70% der PV-Energie.
Es ist alles eine Frage der Co2-Vermeidungskosten.
Selbes gilt betreffend die Nutzung der Überschussenergie von Windkraft!
Wer wird einen Leistungsstarken Elektrolyseur samt aufwendiger Infrastruktur für ca. 600 Jahresbetriebsstunden errichten?
Die mittels „Windstrom“ Nutzung kolportierten im Bau befindlichen Elektrolyse Anlagen, haben von ihrer Leistung abgeleitet, mehr als 6000 Jahresvollastbetriebsstunden! Diese hängen dann 5500 Stunden am Fossilstrom mit einer verheerenden Co2 Bilanz!!!
100Kwh therm. Pzu x η 40% Kraftwerk x η 85% Transformation u. Leitung x η 70% Elektrolyse ergibt einen gesamten η ca. 20%.
Oder 1 Kwh H2 verursacht lt. deutschen Fossilstrommix 2020 (0,97kg Co2/Kwh Endverbrauch) 1630g Co2! Die Kwh Erdgas schlägt mit 215g Co2 zu buche!
Warum wird diese eklatante Schieflage von keinen dieser Diplomierten Ing. erkannt?
Laut https://gas.info/energietraeger-wasserstoff/erzeugung-von-wasserstoff/elektrolyse
sollen bis zum Jahr 2030 in Deutschland Erzeugungsanlagen für grünen Wasserstoff mit bis zu 5Gw entstehen, mit einen Jahresstrombedarf von 20Twh bei ca. 2000 Vollaststunden. Diese Elektrolyseleistung benötigen 880 Windkraftanlagen mit 5Mw Leistung und 4500 Vollaststunden auf See. Kosten der erforderlichen Stromkapazitäten Ca. € 18Mia.
Vom Aufwand zur Erstellung der H2 Infrastruktur vorerst mal abgesehen.
Bei der Betrachtung, dass im Jahr 2020 in D 238,568 Twh Fossil Strom, das sind 53,7% von 100%, verbraucht wurden, genügt nur ein wenig Hausverstand, um den grünen H2-Hyp als LÜGE zu enttarnen!
Die Implementierung der H2 Kapazitäten bei fehlender erneuerbaren elektrischen Produktion, verlagert und verstärkt immens die Co2 Emissionen im Stromsektor, verglichen zum Status Quo.
Hallo Jürgen Schneeberger. Es gibt Idealisten welche weder am Strom- noch am Gasnetz angeschlossen sind. Das kann man in einem Niedrigenergiehaus mit 15 kWp Solarleistung und Wasserstoffspeicherung realisieren. Wenn sie so scharf formulieren, dann bekommen Sie auch so eine Antwort. Sie vergessen natürlich auch das Wesentliche. Im Sommer wird das System auch als Klimaanlage verwenden und im Winter wird aus dem Wasserstoff Strom und Abwärme für die Heizung. Dadurch reduzieren sich ihre Annahmen um ca 30%. Umso größer die Solaranlage ausgelegt ist umso größer ist der Ertrag ihrer Anlage auch im Winter an schneefreien Tagen. Um den Verbrauch von über 3000 kWh im Winter zu decken muss man mindestens 120 T Euro für E-Speicher und die Wasserstofftechnik auf den Tisch legen. Das ist für Idealisten, abgelegene Höfe ohne Anschlüsse oder ähnliches vielleicht sinnvoll. Eine Skalierung wird alle Wasserstoff putrodukte preiswerter machen, aber da ist noch ein langer Weg zu gehen.
Hallo Wopiwo,
ich sehe das auch so, dass Wasserstoff als saisonaler Speicher mit Brennstoffzelle schwierig umzusetzen ist (nicht verfügbare Mengen Palladium, Speicherung des H2 usw.). Sie schreiben, daß eine Wärmespeicherung mittels Wasser mit ca. 50 m3 ausreichen könnte. Meine Frage an Sie: Welche Temparatur muss das Wasser dieses Speichers haben und wie wird dieses Warmwasser dann genutzt? Elektrischer Strom wird ja auch benötigt.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Elektrischen Strom wird man aus warmem Wasser eher nicht gewinnen können. Es gibt zwar thermoelektrische Generatoren, die haben aber nur minimale Wirkungsgrade.
Aus praktischen Überlegungen wird das Wasser eher nicht mehr als knapp 100 Grad aufnehmen können, da ansonsten ein Drucktank benötigt wird.
Zur eigentlichen Frage: Das kann man schlecht in exakten Zahlen beantworten, da der Hersteller schon bewusst unscharfe Angaben macht. Man kann nur sagen „mies“ und „sehr viel“. Über den Daumen gepeilt: PV Ertrag = Heizleistung, siehe unten.
Leider wird überall, wo Grün drin ist, kräftig übertrieben und gelogen oder zumindest insofern gelogen, als dass nur die halbe Wahrheit erzählt wird. Ideologie ist wichtiger als Wahrheit, das sieht man aktuell bei der immer noch geplanten Abschaltung der verbleibenden AKWs.
Wasserstoff ist prinzipiell eine wirklich tolle Sache, wenn man beliebig viel Energie im Überschuss hat. Nur ist das halt fast nie der Fall (außer in Australien oder Marokko).
HPS verspricht einen Gesamtwirkungsgrad von 90%, wobei beim Elektrolyseur ein Wirkungsgrad von 70% versprochen wird. Das ist sehr optimistisch, es gibt wenige Elektrolyseure, die dies tatsächlich schaffen, die in der Realität verfügbaren und üblichen Systeme liegen eher bei 60-65%. Für die Brennstoffzelle behauptet der Hersteller „zwischen 50% und 60%“. Das ist witzig, denn offenbar wissen sie es selbst nicht so richtig. Picea verwendet angeblich eine PEM-Brennstoffzelle. Diese haben typischerweise Wirkungsgrade um die 40%. Nun ist 40% oder 60% nicht gerade ein kleiner Unterschied, dazwischen liegen Welten.
Die notwendige Verdichtung des Wasserstoffs macht in der Realität, abseits Grün-ideologischer Fantasie, zusätzlich zwischen einem Drittel und der Hälfte der aufzuwendenden Energie aus. Oh Mist. Das ignorieren wir besser! Ist das dann eine Lüge? Ich finde schon, aber wenn’s hilft…
Den Wirkungsgrad des DC-DC Wandlers und des Wechselrichters sowie des Lithiumspeichers ignorieren wir ebenfalls. Diese Wirkungsgrade sind zwar bei moderner Technik üblicherweise sehr gut, aber eben um die 90-95%, nicht 100%. Wenn man 3 Komponenten mit jeweils 90% Wirkungsgrad verkettet, kommt hinten nur 72% heraus. Picea arbeitet auch mit vergleichsweise niedrigen Systemspannungen, d.h. sofern man nicht superdicke Kabel verbaut, gibt es in der PV auch noch messbare Wärmeverluste.
Der Wirkungsgrad der elektrischen Speicherkette ist insbesondere wichtig, weil HPS ja damit wirbt, wie besonders schlau ihre die Systeme sind, wie sie vollautomatisch geschickt Startzyklen vermeiden usw — deshalb ist die LiFePo Batterie ja auch derart groß. In anderen Worten: Der Hydrolyser wird mutmasslich auch über die LiFePo Batterie gespeist, wie sollte es anders sein, die Energie muss von irgendwo her kommen. Klar, für den Stack ist das gut, das erhöht die Lebensdauer. Nur ist es in jeder anderen Hinsicht eine Katastrophe. Ach was, keine Sorge. Schlimmer geht immer, man könnte ja auch Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen, um H2 herzustellen. Immerhin, das vermeiden wir! Ist doch toll.
Insgesamt, wenn wir alles zusammenmultiplizieren, haben wir realistisch einen Wirkungsgrad, der irgendwo zwischen (optimistisch) 25% und (pessimistisch) 10% liegt. Realistisch wahrscheinlich um die 20% oder eben 1/5. Wenn man also eine WP mit einem COP von 5 verwendet (die macht aus 1kW Strom 5kW Heizleistung), dann gleicht sich das in der Rechnung genau aus. Für z.B. 20MWh Heizleistung müsste die PV also 20MWh Strom liefern, bei niedrigerem COP entsprechend mehr. Wobei die Heizleistung der Brennstoffzelle noch dazukommt, die über den Daumen gepeilte Annahme 1:1 stimmt also vermutlich auch noch bei einem COP von 4.
Wie gesagt, prinzipiell ist Wasserstoff super. 20% Wirkungsgrad sind zugegeben mies, aber wenn wir nur Energie verwenden, die wir sonst sowieso in die Mülltonne treten würden, dann sind miese 20% immer noch fantastisch. Denn aus Null auf magische etwas zu machen, das ist wirklich wunderbar. Nur sieht die Realität leider nicht so aus, und genau das ist das Problem. In der Realität haben wir selten, und meist mit Unterbrechungen, Energie bis zum Abwinken.
Na und, sagt ihr. Schlechte Wirkungsgrade sind egal, denn die Abwärme verwenden wir zum Heizen, und — wir haben es weiter oben gelesen — im Sommer funktioniert das Ding als Klimaanlage. Was soll also die Aufregung!
Die Wahrheit sieht leider auch hier anders aus. Die meiste Abwärme entsteht im Sommer, also genau dann, wenn wir sie so gar nicht brauchen. Das System muss dann noch zusätzlich Energie aufwenden, um zu kühlen. Von wegen „funktioniert auch als Klimaanlage“, zu diesem Unsinn sollte man eigentlich besser nichts sagen. Sofern man nicht noch zusätzlich eine halbe Million Euro in einen Sorptionskühler investiert, wüsste ich nicht, wie man aus Hitze Kälte machen sollte.
Bestenfalls kann man die im Haus vorhandene Wärmepumpe als Klimaanlage nutzen, das wird in der Praxis auch getan, ist aber eine wirklich schlechte Lösung. Denn üblicherweise wird mit der WP nicht die Luft erwärmt, sondern der Fußboden beheizt. Das ist sehr effizient und angenehm dazu. Kehrt man diesen Prozess nun um, hat man im besten Fall einen kalten Fußboden (unangenehm), im schlechtesten Fall Tauwasser. Für den Betrieb der Wärmepumpe als Klimaanlage ist aber in jedem Fall Energie notwendig, die gibt’s nicht umsonst, das ist einfach eine Lüge.
Hydrolyseure gibt es ja neuerdings mit Wirkungsgraden von 98%, jedenfalls wird das behauptet. Die Elemente sollen übrigens auch noch kostengünstiger und sehr wartungsfreundlich sein. Ja wunderbar, da muss ich doch sofort investieren, denen gebe ich sofort mein Geld.