0,275 Cent pro Kilowattstunde kostet es, um aus Graustrom Ökostrom zu machen. Graustrom ist alles, was an der Strombörse gehandelt wird. Er stammt aus Atomkraftwerken, Braunkohlekraftwerken, Steinkohlekraftwerken. Immerhin ist auch der Strom aus den Solar- und Windkraftanlagen dabei, deren Betreiber mit der Einspeisevergütung oder der Marktprämie aus dem EEG-Umlagetopf bezahlt werden. Das sind inzwischen rund 30 Prozent.
Doch was sollen diejenigen tun, die über die verpflichtende EEG-Umlage hinaus etwas für die Energiewende tun wollen? Die gern bewusst grünen Strom kaufen wollen? Schon länger gibt es Ökostromtarife diverser Anbieter. Zu Ökostrom wird der Graustrom mithilfe der sogenannten Herkunftsnachweise. Die Idee dahinter ist logisch. Für das globale Klima ist es egal, wo Dreckschleudern durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Wenn es in Norwegen mit Wasserkraft einfacher geht als hierzulande – bitte. Das kann Sinn ergeben, selbst wenn der Strom physisch nicht nach Deutschland geleitet wird.
Nur, für 0,275 Cent pro Kilowattstunde wird ein Kohlekraftwerk nicht einmal in Norwegen durch ein Wasserkraftwerk ersetzt. Auch die 0,4 Cent pro Kilowattstunde, die die Herkunftsnachweise von „Northern Continental Wind“ kosten, werden nicht dazu beitragen, neue Windkraftwerke zu bauen. Solange es viel mehr Ökostrom gibt als Abnehmer, solange werden die Preise nicht steigen. Man könnte es auch so ausdrücken: Wenn es vielen Verbrauchern wichtig genug wäre, Ökostrom zu kaufen, könnte das System funktionieren. In der jetzigen Situation hilft es der Energiewende jedoch nicht.
Beitrag neuer Geschäftsmodelle
„Das System der Herkunftsnachweise ist etabliert und prinzipiell in Ordnung“, sagt Thorsten Lenck, Manager bei Energy Brainpool. Dazu gibt es beim derzeitigen Strommarktdesign wenig Alternativen. Nur eine Quote, die Verbrauchern einen Ökostromanteil vorschreibt, würde den Preis steigen lassen. In Deutschland habe man sich aber entschieden, über direkte Zahlungen entsprechend dem EEG den Erneuerbaren-Ausbau anzureizen. Außerdem kann es im Prinzip auch Stromtarife geben, die Erneuerbare-Energien-Anlagen voll finanzieren. Es ist möglich, den Strom eines Photovoltaikkraftwerks direkt zu vermarkten, ohne die Marktprämie aus dem EEG-Umlagetopf zu beziehen. „Doch das ist den meisten zu teuer“, sagt Lenck.
Viele der neuen Geschäftsmodelle sind daher ein Versuch, mit umlagefinanziertem EEG-Strom Verbrauchern zusätzlichen emotionalen Mehrwert zu bieten. Das ist gar nicht so einfach, da für Strom aus deutschen EEG-Anlagen das Doppelvermarktungsverbot gilt. Dieser Strom verliert durch das EEG seine Eigenschaft als Grünstrom, sodass für ihn auch keine Herkunftsnachweise ausgestellt werden können. Es soll niemand daran verdienen dürfen, dass er den bereits mit den Einspeisetarifen vergüteten Strom nochmals als besonders umweltfreundlich vermarktet.
Die Sonnen-Community etwa verkauft offiziell keinen Ökostrom. Stattdessen formiert sie sich, indem sie nur Erneuerbare-Energien-Anlagen als Erzeuger zulässt. Nur ausnahmsweise sei es nötig, so Phillip Schröder, Sonnen-Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb, im pv magazine -Interview, Strom an der Börse zuzukaufen (www.pv-magazine.de, Webcode 6382). Sonnen vermittelt den Kunden damit auf elegante Art, dass sie überwiegend Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Die Anlagenbetreiber kommen trotzdem in den Genuss der Umlagefinanzierung.
Aber nur weil sich viele Kunden für die Community entscheiden, entsteht noch lange kein finanzieller Anreiz für Windmüller und Solarinvestoren, neue Anlagen zu bauen. Das Gleiche gilt für Lumenaza, für die Senec-Cloud und für die regionale Grünstromkennzeichnung, für die das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) im März ein Eckpunktepapier vorgestellt hat. Wird es unverändert umgesetzt, können Versorger in den Stromabrechnungen den Bezug regionalen EEG-Stroms ganz offiziell gesondert ausweisen.
Da die Konzepte keinen Anreiz schaffen, mehr erneuerbare Energien zuzubauen, lässt ein bekannter Ökostromanbieter auch kein gutes Haar an ihnen. Weder sei das System mit den heutigen Regelungen gut, noch werde es mit den geplanten besser. Im Gegenteil, eine wie auch immer geartete Weiterentwicklung des jetzigen Systems der Stromkennzeichnung mache das System immer schlimmer und undurchsichtiger. Schon heute sei das Problem, dass Versorger, ohne sich für die Energiewende zu engagieren, mit dem EEG-Stromanteil im Graustrom 40 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien ausweisen. Selbst dann, wenn sie bewusst 100 Prozent konventionellen Strom einkaufen. „Jetzt behaupten zu wollen, ein Anteil dieses ‚Nicht-Anteils‘ käme auch noch aus der Region, ist die Spitze der Verbrauchertäuschung“, sagt der Energiemarktexperte.
Viele Experten können den Konzepten trotzdem Gutes abgewinnen und sind teilweise sogar begeistert. Sie könnten die Energiewende nämlich auf andere Art und Weise voranbringen.
Die Stadt Wolfhagen in Nordhessen gilt als eines der Vorzeigebeispiele für eine regionale Energiewende. Die örtliche Bürgerenergiegenossenschaft hat Anteile am Stadtwerk, und dieses versucht, eine Art Blaupause für die Energiewende in ganz Deutschland zu werden (siehe pv magazine Juni 2015, Seite 82). „Ich finde die regionalen Konzepte klasse“, sagt Alexander Rohrssen, Prokurist der Stadtwerke. Das hat zum einen mit der Akzeptanz zu tun. Wenn man zum Beispiel ein Windrad in Sichtweite hat, „dann findet man sie schon nicht mehr so hässlich, wenn auch der Strom von dort kommt“.
Das mag ein eher vertrieblicher Aspekt sein. Auch das kann für die Energiewende wichtig sein. Doch es gibt auf der anderen Seite auch handfeste technische Aspekte, die für die regionalen Konzepte sprechen. Wolfhagen hat sich wie die gesamte Stadtwerkeunion Nordhessen, zu der das Stadtwerk gehört, das Ziel gesetzt, nicht nur bilanziell den Strom regional zu erzeugen, sondern Erzeugung und Verbrauch auch so gut wie möglich regional auszugleichen. Wenn das zufriedenstellend gelingt, lässt sich die Netzanschlussleistung des örtlichen Mittelspannungsnetzes an das Hochspannungsnetz reduzieren. Das wäre ein eindeutiges Zeichen, dass durch die Regionalität die Übertragungsnetze weniger ausgebaut werden müssen. Dafür können, so Rohrssen, Technologien, wie sie Unternehmen wie Lumenaza entwickeln, sehr hilfreich sein.
Derzeit organisiert das Start-up den Ausgleich von sogenannten Bilanzkreisen seiner Kunden. An einen Bilanzkreis sind die Verbraucher und Erzeuger angeschlossen. An einem Tag kauft oder verkauft der Bilanzkreisverantwortliche für jede Viertelstunde des Folgetags Strom an der Börse, sodass Verbrauch und Stromangebot gleich hoch sind. Je besser man Verbrauch und Erzeugung regeln kann, desto besser kann man hinterher eingreifen und mithelfen, das Ziel zu erreichen. Im Prinzip müssen die Werte also nicht deckungsgleich sein, sie sollten nur so gut prognostiziert sein, dass der Zu- oder Verkauf richtig geplant wird. „Das entspricht aber nicht unserer Vision“, sagt Lumenaza-Mitgründer Oliver March. Die Vision ist, dass möglichst wenig an der Strombörse gehandelt werden muss und damit der Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch wirklich regional stattfindet. Beim Referenzkunden Fichtelgebirgsstrom dienen dazu zwei Biomassekraftwerke.
Um die Anschlussleistung des regionalen Mittelspannungsnetzes an das Übertragungsnetz im Wolfhagener Beispiel zu reduzieren, fehlt dann aber noch ein weiterer Schritt: Der Ausgleich muss zeitgleich erfolgen statt innerhalb einer Viertelstunde, denn Elektronen richten sich nicht nach von Menschen definierten Zeitfenstern. „Da muss man noch mehr Parameter mit hineinnehmen“, sagt Rohrssen, „aber das ist machbar.“ Er hält die automatisierten Steuerungen der Bilanzkreise für einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Für wichtig hält er übrigens auch, dass auch die lokale Netzbelastung mit berücksichtigt wird, also Netzengpässe im Verteilnetz reduziert werden. Doch auch dafür sei das Konzept der richtig Anfang.
Auch Thorsten Lenck sieht die positiven Aspekte. Nicht nur dass solche Modelle Akzeptanz schaffen. „Dadurch kommen auch Speicher und ganz neue Technologien in den Markt“, sagt er. Selbst wenn derzeit nicht alles betriebswirtschaftlich rational erscheine, hält er diese Infrastruktur in Zukunft für sehr wichtig und sie werde sich bestimmt noch weiterentwickeln.
„Die alte Energiewirtschaft ist zentral organisiert“, sagt der Energiemarktexperte. „Wir brauchen Technik, mit der sich eine dezentrale Struktur aufbauen lässt.“ Wenn die Speicher erst da sind, wird man sie auch nutzen können. Wenn man sie dann auch noch für die Regelleistung nutzen kann – umso besser. Und wenn es mit den heutigen Regularien schwierig sein sollte, „die kann man auch anpassen“ (siehe auch Kasten zum Econamic Grid Seite 44). Derzeit seien die Early Movers an der Reihe, die die Veränderungen antreiben.
Der über-über-übernächste Schritt
Dass die bisherigen Ansätze nur der Anfang auf dem Weg in ein neues Energiedesign sind, zeigte im Mai ein Workshop der Solarpraxis Neue Energiewelt. Seit einigen Monaten entwickelt sich in der IT-Start-up-Szene ein neuer Hype mit dem Namen Blockchain. Die Technologie steht hinter der Internetwährung Bitcoin. Das Besondere an ihr ist, dass sie keine zentrale Instanz benötigt, die Vertrauen erzeugt. Es gibt keine Bitcoin-Zentralbank. Die Vertrauenswürdigkeit wird hergestellt, indem auf vielen verteilten Rechnern der Nutzer die Daten in irgendeiner Form abgelegt werden – vollkommen fälschungssicher, wie IT-Experten sagen. Nun geht es darum, was damit in der Energiewelt möglich ist.
Die Blockchain-Technologie minimiert zum einen die Transaktionskosten für Zahlungsabläufe. Zum anderen ist sie die Grundlage für sogenannte DAOs – Decentralized Autonomous Organizations. Diese funktionieren weitgehend automatisiert, mit automatisierten „smart contracts“ und ohne zentrale Instanz. Eine der konkreten Anwendungen präsentierten Experten vom Beratungsunternehmen ITP aus Berlin auf einer Veranstaltung. Sie stellten eine Konzeptidee vor, wie sich eben ohne zentrale Instanz, also ohne Stadtwerk oder Versorger, Regionalstromkonzepte umsetzen lassen. Solaranlagenbetreiber können damit von ihren Nachbarn unter durchaus realistischen Annahmen rund 300 Euro pro Jahr mehr verdienen – ein echter Anreiz für den Neubau von Anlagen. In Brooklyn betreiben zwei Start-ups sogar schon etwas Ähnliches. Das „transactive grid“ erlaubt den Peer-to-peer-Verkauf von Solarstrom. Die möglichen Blockchain-Anwendungen gehen dabei weit darüber hinaus – am Ende könnte ein vollautomatisiertes Stromnetz ohne zentrale Instanz möglich sein.
Dass das nicht ganz so irre ist, wie es auf den ersten Blick scheint, zeigte der Rahmen der Veranstaltung, bei der ausgerechnet zwei zentrale Instanzen federführend waren: Sie fand bei Vattenfall in Berlin statt, und einer der Redner war Carsten Stöcker vom Innovation Hub von RWE.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.



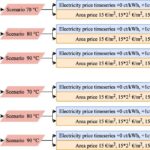


Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass das pv magazine Ihre Daten für die Veröffentlichung Ihres Kommentars verwendet.
Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Spam-Filterung an Dritte weitergegeben oder wenn dies für die technische Wartung der Website notwendig ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist aufgrund anwendbarer Datenschutzbestimmungen gerechtfertigt oder ist die pv magazine gesetzlich dazu verpflichtet.
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Andernfalls werden Ihre Daten gelöscht, wenn das pv magazine Ihre Anfrage bearbeitet oder der Zweck der Datenspeicherung erfüllt ist.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.