Die Photovoltaikbranche ist voll von Qualitätsversprechen. Seien es bis zu 30 Jahre währende Leistungsgarantien, Produktgarantien oder andere Zusagen, die beim Kauf von Solarmodulen gegeben werden, wie zum Beispiel das topmodische Versprechen, PID-frei zu sein. Gleichzeitig versuchen die vielen hunderte von Modulherstellern, weltweit Marken aufzubauen, wofür oftmals gewaltige Werbeanstrengungen unternommen werden. Dazu kommt der Aufbau eigener Service- und Sales-Teams.
All dies geschah bisher weltweit in einem künstlich geschaffenen Markt, in dem die Politik die Rahmenbedingungen diktierte. Dies mündete einerseits in Preisvorgaben für den Strom und andererseits in zum Teil grotesken Zeitvorgaben (Stichtage). Der Markt wippte so zwischen Superboom und Flauten auf ein immer höheres Niveau mit derzeit heftigen Überkapazitäten in der Modulproduktion und auf anderen Wertschöpfungsstufen. Allerdings immer getrieben von nahenden Stichtagen, auslaufenden Förderungen und einem daraus resultierenden Investitionstourismus, der oftmals von blankem Glücksrittertum begleitet wurde.
Vergleicht man vor diesem Hintergrund aktuelle Qualitäts- und Markenversprechen mit der Realität, so zeigt sich ein ziemlich ernüchterndes Bild. Eine Reihe von Beispielen aus dem Beratungsalltag der Solarpraxis AG und privaten Erlebnissen meinerseits soll besonders klaffende Lücken verdeutlichen, um Hinweise und Ideen für eine weitere Professionalisierung der Branche zu liefern. Viele der Punkte haben noch nicht einmal was mit Extrakosten zu tun, sondern schlicht mit Struktur und vor allem dem Willen zu guten Produkten.
Investoren/Handel/Handwerk – kein schönes Bild
„Einfältig, gierig, untreu“ – „Die kaufen jeden Scheiß“ – „Das hält niemals 20 Jahre“, so die Originalzitate von genervten Herstellern, Händlern und Finanzierern, wenn man sie nach dem Verhalten von Investoren und deren Handwerkern beziehungsweise Lieferanten fragt. Endkunden, die kleine und mittlere Anlagen kaufen, vertrauen dabei in der Regel auf ihre Installateure, und diese oftmals handwerklich geprägten Betriebe vertrauen wiederum auf ihre Händler oder die Industrie. Damit hängt das Wohl und Wehe der Käufer am Ende ausschließlich von der Entscheidung der Lieferanten ab, die sich oft einfach nicht vorstellen können, welche dramatischen Mängel auch ein gut aussehendes Solarmodul haben kann.
Warum auch, haben doch „normale“ Elektro- und auch SHK-Handwerker oftmals seit vielen Jahrzehnten stabile Lieferanten in ihrem Kerngeschäft, verbunden mit klaren Service- und Umgangsstrukturen, die sich in der Photovoltaikbranche vielfach erst noch entwickeln müssen. „Mir sind die Hersteller doch egal, die bescheißen mich eh nur“, denkt sich der Händler, und dann wird einfach Ware beim No-Name-Hersteller beschafft und notfalls auch noch umgelabelt. Macht nix, denn im Internet gibt es ja lustige Bilder von abfallenden Labeln, unter denen dann das kaum lesbare Originallabel erscheint. So weit, so schlecht.
So dürfte in den vergangenen Jahren in vielen Fällen der Grundstein für erhebliche Probleme in den kommenden Jahren gelegt worden sein. Das hat auch damit zu tun, dass Handwerker vielfach in existenzielle Probleme gerieten, weil Hersteller sie einfach nicht belieferten, weil diese wiederum selbst keine Zellen oder auch Silizium bekamen. Dann mussten sie eben irgendwas kaufen. Auch viele Großinvestoren haben in dieser Zeit jedes Modul gekauft, egal, wo es herkam.
Andere, die auf Qualität achteten, wurden dann aber auch auf verschiedene Arten von den sogenannten „Brandnames“ enttäuscht. Daher gibt es aus Sicht verschiedenster Beobachter auch noch keine wirklich starken Marken, bei denen die Kunden unbesehen kaufen. Eine harte Ansage für alle, die auch unter massivem Druck noch eine langfristig gute Qualitätsarbeit anbieten wollen. Doch wo lag und liegt nun der Hase im Pfeffer?
Die richtigen Standards schaffen
„Wir sind PID-frei“, ist derzeit eine Modezusicherung (PID = potenzialinduzierte Degradation). Aber wehe, wenn man dann im Labor feststellt, dass das Modul doch nicht PID-frei ist. Dann heißt es: „Das Messverfahren ist nicht genormt.“ Oder: „So etwas hatten wir in Europa noch nie, das gibt es nur in den Tropen.“ Nur der Druck einer Bank, man würde gegebenenfalls die Bankability verlieren, führt dann zu einem Einlenken. Oder auch nicht. Eigentümlicherweise lassen es auch bekannte Labore in diesem Kontext zu, dass mit den PID-frei-Resultaten von sogenannten Golden Samples geworben wird. Die vom Hersteller speziell für den Test auswählten Module bestehen dann die Prüfung, während die Probleme in der Serie klar erkennbar auftreten. Die betroffenen Prüfinstitute sollten hier per Gericht von den Herstellern einfordern, dass die Hersteller nicht mit PID-Freiheit werben, wenn dies erwiesenermaßen nicht stimmt. Alles andere lässt dieser Form von Pfuscherei breiten Raum, und es schadet auch dem Leumund der betroffenen Prüfinstitute.
Es gibt auch große Unterschiede in der Behandlung eines solchen Problems: Während kleinere Marken oft sofort eine Nachrüstung der Anlage bezahlen, winden sich große Marken wie Aale und versuchen, das Problem kleinzureden. Und das, obwohl sich in der Serie eindeutig zeigt, dass die Laborprüfungen vom Serienprodukt abweichen, mit allen theoretischen und praktischen Folgen. Denn im Grunde ist das Produkt dann oftmals nicht mehr das zertifizierte. Das heißt in Deutschland juristisch dann „wandelbar“, darf also ohne Wenn und Aber an den Hersteller retourniert werden.
Eine weitere Quelle großen Ärgers sind auch die Auffassungen zum LID-Effekt, also der lichtinduzierten Degradation. Diese gibt es sowohl bei Dünnschichtmodulen als auch bei kristallinen Produkten. Den LID-Effekt halten viele Hersteller für so normal, dass der Kunde eben damit leben muss, wenn wenige Tage nach der Inbetriebnahme auch bei kristallinen Produkten drei bis sieben Prozent der Labelleistung weg sind. Hatte der Kunde nicht 240 Wattpeak gekauft? „Nein, in unserem Vertrag können drei Prozent weg sein.“ O.k., wenn es ein Profikunde so unterschreibt. Aber dann zahlt er im Grunde drei Prozent mehr, als auf dem Preisschild steht. Und der Nicht-Profikunde, also die ganze große Mehrheit, kriegt einfach weniger Leistung. Nicht normal und allerhöchste Zeit für bessere Standards in der Branche.
Zu den ganz großen Themen gesellt sich dann auch die Definition von (Leistungs-)Toleranzen, für die es offenkundig sehr unterschiedliche Interpretationen gibt. Kunden definieren sie anders als Hersteller, und so taucht immer wieder die Frage auf: Was bekomme ich eigentlich, wenn ich ein Megawattpeak eines Moduls mit jeweils plus/minus drei Prozent Leistung je Modul kaufe? Ein Megawatt, müsste die Antwort lauten – kommt mehr raus, ist es eben mehr, sonst eben weniger. Aber je nach Standpunkt geht dann sofort die Streiterei los, noch verstärkt durch die gerade bei Dünnschicht dramatischen Messfehler und eine eigenwillige Interpretation zum Beispiel von 90-Prozent-Leistungsgarantien.
Ausgangspunkt ist die Labelleistung des Moduls. Davon wird zunächst die Leistungstoleranz abgezogen, bei älteren Modulen bis zu fünf Prozent. Dann werden die Messungenauigkeiten berücksichtigt, was bei Dünnschichtmodulen zu einem weiteren Minus von bis zu sechs Prozent führen kann. Da dann auch noch nur 90 Prozent der Leistung garantiert werden, kann man weitere zehn Prozent vom Ausgangswert abziehen. Das bedeutet, dass sich der Hersteller in einem konkreten Beispiel erst mit einem Minus von grob 21 Prozent überhaupt in der Pflicht sah. Bei einem Megawattpeak eingekaufter Nennleistung bedeutet das eine theoretisch mögliche Minderleistung von 210 Kilowatt. Nicht normal.
Hier ist es dringend erforderlich, einheitliche, branchendefinierte Lösungen zu schaffen und die Abhängigkeit von Einzelverträgen zu beenden. Zumal die Endverbraucher keinerlei Einfluss auf Verträge zwischen Hersteller und Handel haben und dann gegebenenfalls einfach zehn Prozent weniger Leistung bekommen als bestellt.
Deutsche Qualität und Pleiten
Gerade die deutsche Solarindustrie hat immer mit hoher Qualität, Service und Seriosität geworben und ist dabei nicht müde geworden, vor den Gefahren asiatischer Billigprodukte zu warnen. Allerdings gab es bisher keine konzertierten Aktionen, Zusicherungen oder gar insolvenzsichere Garantieversprechen aufgrund irgendeiner Art von übergreifender Zusammenarbeit. Auch gibt es bis heute keine Infomaterialien, in denen die proklamierte bessere Qualität auch für den Endverbraucher oder Handwerkskunden erläutert und vergleichbar gemacht wird. Denn deutsche Solarmodule sind eben leider keine BMWs, Audis oder Mercedes, sondern im Grunde ein unbekanntes Produkt, dessen Eigenschaften sich nur schwer vor dem Kauf differenzieren lassen.
Es kann aber auch sein, dass meine private Solaranlage ein sehr gutes Produkt ist und die deutsche Herstellerfirma trotzdem pleiteging. Dann kann ich nur hoffen, dass die Nachfolgefirma überlebt, denn sonst sind alle Garantien, die ich erhalten habe, wertlos. Ich könnte natürlich versuchen, den Händler zu belangen und haftbar zu machen. Damit hätte ich, wie verschiedene Fälle bereits gezeigt haben, am Ende vielleicht sogar gute Chancen auf Erfolg. Leider wird dadurch dann unter Umständen auch der Händler in den Bankrott getrieben.
Ebenfalls wenig vertrauenerweckend sind weitere Beispiele, bei denen Handwerker sich lösende Typenschilder angeblich deutscher Produkte entfernten und sich darunter die schon erwähnten nicht lesbaren oder asiatischen Typenschilder fanden. Es gibt grundsätzlich nichts gegen eine OEM-Fertigung bei Dritten einzuwenden, allerdings fragt man sich bei dieser sehr speziellen Art dann doch, ob das Produkt jemals die versprochene deutsche Qualitätskontrolle sah. Und natürlich fragt sich der Kunde, warum er für das gleiche Produkt mit abfallendem Label bis zu 30 Prozent mehr bezahlen musste als bei einem direkten Kauf des Originals. Fragen nach der Haftungskette im Falle einer Insolvenz der vorgeblich deutschen Marke inklusive.
Gerade wenn Versprechen auf Basis der Herkunft abgegeben werden und damit höhere Preise erzielt werden sollen, müssen solche Dinge die Ausnahme bleiben. Und die Branche muss einen Standard entwickeln, um Trittbrettfahrer abzuwehren. Sonst kaufen die Kunden am besten gleich das billigere Wettbewerbsprodukt – oder, wie ein Handwerker sagt: „Die bescheißen mich genauso, sind aber billiger.“ Angesichts der vielen Pleiten müssen weiterhin aktive Unternehmen zudem nach Lösungen suchen, um den Kunden auch Gewährleistungen nach einer möglichen Insolvenz zu bieten.
Made in Europe
In die Falle des sogenannten Overpromising lief auch ein bekannter europäischer Hersteller, als sich herausstellte, dass seine Produkte doch asiatische Laminate waren und nicht „made in Europe“. Auch sonst zeigten die Module eine eher schlechte Performance in Tests, zudem gab es permanente Wechsel von Vertriebsstrategien, Strukturen und Ansprechpartnern und die bis 2011 typischen abrupten Preiserhöhungen oder Nichtbelieferungen.
Eine andere, aus nicht nachvollziehbaren Gründen bereits lange am Markt agierende europäische Marke hat eine Erfolgsbilanz, die kaum verheerender sein kann: „Da funktioniert nichts: schlechte Qualität und keine Ansprechpartner. Bei Reklamationen ist man immer sofort am Rande des Gerichtsprozesses. Aber die konnten halt früher liefern“, erzählt ein betroffener Systemintegrator. Offenkundig hat sich das Unternehmen in eine Art staatliche Sicherung begeben, sonst wäre dort auf dem Rücken der Kunden bereits lange Schluss. Eine Fortsetzung dürfte hier daher leider folgen.
Auch auf dieser europäischen Ebene müssen sich die Unternehmen schnell weiterentwickeln, um eine Daseinsberechtigung zu erhalten. Denn die von vielen der Unternehmen gewünschten Importzölle auf chinesische Produkte werden das eigene schwache Verhalten gegenüber den Kunden bei hohen Kosten nicht auf Dauer ausgleichen.
Asien – ein buntes Bild
Ein großer, weiterhin tätiger Asiate verhielt sich 2009 bis 2011 genauso, wie die Vorurteile es nahelegten. Bereits bei einem Factory Audit zur Qualitätssicherung wäre das Geschäft fast geplatzt. Das Lieferverhalten besonders im Jahr 2010 geriet dann vollkommen zur Farce. Einmal mehr galt die vermeintliche Regel, dass Verträge in der Photovoltaikindustrie nichts wert sind. Die gelieferten Produkte hatten zudem weniger als die versprochene Labelleistung, es fehlten Zertifikate, und die Inhaltsstoffe der Module waren unklar. „Schneckenspuren“ auf den Modulen und dann viel Theater mit diversen Labortests sorgten für zusätzlichen Unmut. Zumindest stand die Marke am Ende auch zu ihren Zusicherungen. Wenn auch mit viel Druck, wurden entsprechende Preisanpassungen vorgenommen, um die Probleme ohne gerichtliche Auseinandersetzung aus der Welt zu schaffen.
Ein anderer, vom Volumen großer Hersteller fällt dann im Jahr 2012 bei einem intensiven Test (vor dem Einkauf) mit Pauken und Trompeten durch. Die Vermutung des Kunden lag auf einem Serienfehler. Reaktion? Keine. Denn es wird gerade umstrukturiert, und die Ansprechpartner sind alle raus. Kunde weg und einmal mehr verunsichert. Wenn so etwas bei einem Großen passiert, wem kann ich dann noch trauen?
Zwei weiterhin bestehende große Dünnschichtanbieter haben zum Beispiel Probleme mit ihrer Labelpolitik und dem Beschreiben ihrer Schwachlichtperformance. Die Module verlieren erkennbar mehr an Anfangsleistung als vertraglich und in den Datenblättern kommuniziert. Somit sind dann schon nach kurzer Zeit durchaus mehr als zehn Prozent der Leistung weg. „Messfehler, erkennen wir nicht an. Bei uns ist alles o.k.“ Oder: „Schwachlicht haben wir nicht zugesichert. Die von uns dazu gelieferten Simulationsdaten haben keine Bedeutung.“ Batsch. Und während es dem Kunden gelingt, in einem Fall eine einigermaßen sinnvolle „Kulanz“ zu erzielen, verbunden mit einer Nachlieferung, geht das andere Ding krachend vor Gericht. Großer Konzern gegen kleine Entwickler. Und das mit Methode, denn von den fünf bekannten Kunden mit Problemen im mehrfachen Megawattbereich hat es nur einer geschafft, Geld einzubehalten und einen sinnvollen Gerichtsstand zu vereinbaren. Dieser eine wehrt sich nun und beginnt eine Messtechnik-Odyssee, in der fast alle der hier genannten Themen aufpoppen.
Prüfinstitute widersprechen sich
Während dieser Messungen ergab sich dann auch die wenig schöne Erkenntnis, dass sich namhafte Prüfinstitute widersprechen und dass die neuen Ergebnisse eine lange bekannte Technikstrecke eigentlich unverkäuflich machen. Denn wenn ich mich lange streiten muss, um überhaupt zu wissen, was ich bekommen habe oder bekommen könnte, brauche ich diese Technik nicht zu kaufen. Die anderen Kunden des genannten zweiten Konzerns sind entweder hilflos oder werden vom Konzern sogar noch bedroht, nach dem Motto: Wenn ihr Aussagen macht, brecht Ihr NDAs (Geheimhaltungsverträge), und das wird dann bitter für euch. Das Ganze natürlich juristisch so verklausuliert, dass man kaum etwas dagegen sagen kann. Außer eben pleitezugehen, weil die Anlagen an einen Punkt kommen, wo die Finanzierungen platzen. Und dann helfen weder Leistungsgarantien noch vorhandene Rückversicherungen, denn beide greifen erst, wenn die Kunden die Forderungen mit der Brechstange durchsetzen.
Andere Dünnschichtlieferanten schaffen es aber, die versprochenen Leistungen zu klar definierten Regeln zu liefern und auch die Degradation der Module im vereinbarten Rahmen zu halten. Auch sonst gut: Die Kunden beginnen, mit der Marke zu werben, und investieren in passende Systemtechnik und eine entsprechende Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Bis dann auf einmal die Entscheidung getroffen wird, in bestimmten Märkten nicht mehr oder nur noch zu sehr hohen Preisen aktiv zu sein. Marke ade, Investitionen weg.
Andere haben keine Marke und geben auch nichts dafür aus, die Qualität stimmt dennoch. Und so werden die Produkte dann auch unter Handelsnamen importiert. Aber nur, solange die Preise stimmen. Wenn das nicht mehr geht: Goodbye. Hier wäre das bereits beschriebene genauere Hinsehen der Einkäufer in die andere Richtung sinnvoll, denn ohne treue Kunden zahlt sich Qualität nicht aus.
Man kann das natürlich auch andersrum machen und nicht mal für die Übersetzung der eigenen Herstellerwebsite Geld ausgeben. Macht Google ja für lau. Die Module sind dafür krass billig und verfügbar. Gekauft. „Wünschen Ihre Kunden eine Eingangskontrolle oder einen Factorycheck?“ – „Nein, wollen sie nicht.“ Kaufen Investoren also wirklich jeden Dreck? Oder welche Lerneffekte gibt es im jungen Photovoltaikmarkt? Wir bleiben dran.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.





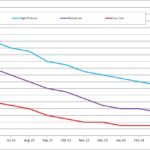
Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass das pv magazine Ihre Daten für die Veröffentlichung Ihres Kommentars verwendet.
Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Spam-Filterung an Dritte weitergegeben oder wenn dies für die technische Wartung der Website notwendig ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist aufgrund anwendbarer Datenschutzbestimmungen gerechtfertigt oder ist die pv magazine gesetzlich dazu verpflichtet.
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Andernfalls werden Ihre Daten gelöscht, wenn das pv magazine Ihre Anfrage bearbeitet oder der Zweck der Datenspeicherung erfüllt ist.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.