Wie kamen Sie zu dem Projekt „Passendorfer Schloss“?
Zschuckelt: Vor circa zwei Jahren ist der Investor an uns herangetreten, weil wir uns mit erneuerbaren Energien und alternativen Konzepten auskennen. Er hatte das Gelände in Halle gekauft und wollte dort Eigentumswohnungen errichten und die Möglichkeit zu altersgerechtem Wohnen schaffen. „Das soll was ganz Tolles werden“, hat er gesagt. Er wollte was Innovatives machen und ein Stück Unabhängigkeit schaffen von der Grundversorgung und von sonstigen Anbietern. Außerdem wollte er die Wirtschaftlichkeit für sich selbst als Investor und für die Bewohner testen.
Wer ist der Investor?
Zschuckelt: Das ist die Sikan Projektgesellschaft mbH in Halle an der Saale, ein Privatinvestor. Er hat auch eine ganze Reihe weiterer Wohnungen oder Grundbesitz im mitteldeutschen Raum, in Halle und Magdeburg.
Sie sagen, es soll einen Nutzen für die Bewohner der Wohnungen und für den Investor geben. Inwiefern?
Zschuckelt: Hier gibt es diese Win-win-Situationen für den Mieter und für den Investor. Einerseits möchte der Investor eine Verzinsung seiner Investition erreichen, andererseits soll die Einsparung für die Bewohner attraktiv sein. Hier gilt es, das richtige Maß auszuloten.
Haben Sie ihm in der Planung dazu verschiedene Vorschläge gemacht?
Zschuckelt: Genau. Wir haben das dem Investor vorgerechnet und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. Man muss eines bedenken: Dadurch, dass Letztverbraucher den Stromanbieter frei wählen können, muss ein Investor das Konzept für die Bewohner attraktiv machen, wenn es erfolgreich sein soll. Das können ein Kostenvorteil sein und Soft Facts, dass es grüner Strom ist. Aber am Ende zählt für die meisten Menschen das, was zwischen Daumen und Zeigefinger dabei herausspringt. In unserem Projekt haben jetzt alle Bewohner zugestimmt.
Inwiefern rechnet sich das für die Bewohner?
Werner: Was die Wirtschaftlichkeit angeht, haben wir einen guten Weg gefunden. Die Bewohner sparen 15 Prozent gegenüber dem lokalen Versorger, Wärme und Strom zusammengerechnet. Das sind rund 240 Euro im Jahr für einen Durchschnittshaushalt.
Zschuckelt: Zur Optimierung kommt es darauf an, wie groß das Pellet-BHKW ist und wie die Voraussetzungen für Photovoltaik sind, mit welchen Zinssätzen und Laufzeiten für die Kredite man kalkuliert. Außerdem muss man noch Annahmen treffen, wie hoch die Pelletpreise in einigen Jahren sein werden.
Das Projekt erreicht auf die ganze Energie bezogen rund 85 Prozent Autarkie. Dahinter steht ja eine Entscheidung. So schalten Sie das BHKW im Sommer ab, um Kosten zu sparen. Gleichzeitig reduziert das die Autarkie. Haben Sie in dieser Hinsicht verschiedene Vorschläge gemacht?
Werner: Zu Beginn stand auch eine komplette Insellösung im Raum. Das haben wir auch durchgerechnet. Es hat sich aber herausgestellt, dass es nicht umsetzbar ist, wenn die letzte Kilowattstunde vor Ort produziert werden muss. Das wird zu teuer.
Was würde ein zusätzlicher Batteriespeicher bringen?
Zschuckelt: Wir rechnen das gerade. Mit dem Investor haben wir aber besprochen, dass wir zunächst nur die Photovoltaikanlage bauen. Die kommt jetzt im Herbst. Dann testen wir, inwieweit wir das Heizungssystem mit der Photovoltaik unterstützen können. Ein Batteriespeicher ist in Zukunft eine Möglichkeit. Wir denken aber noch mehr darüber nach, was sich durch Elektromobilität für Möglichkeiten bieten.
Den solaren Überschussstrom nutzen Sie, um direkt den Wärmespeicher zu heizen. Ökonomisch macht das ja eigentlich keinen Sinn. Wenn Sie einspeisen, verdienen Sie mehr, solange die Kilowattstunde Pelletstrom vier oder fünf Cent kostet.
Werner: Ja, natürlich. Aber es geht nicht immer um den letzten Euro, sondern auch um das Gesamtkonzept. Es soll ein Modellprojekt für eine lokale Energiewende sein und ein Leuchtturmprojekt für den Investor.
Zschuckelt: Es ist eine bewusste Entscheidung. Er wollte die Möglichkeit, mit den Heizstäben zu heizen, unbedingt haben.
Was waren für Sie die größten Herausforderungen?
Werner: Das Ganze in einen rechtlichen Rahmen zu fassen war kompliziert. Rechtlich gibt es etliche Unklarheiten. Wir mussten viel mit Landesregulierungsbehörden und mit Netzbetreibern diskutieren. Wir mussten alle mit ins Boot holen.
Der Investor hat eine Gesellschaft, die die Energieversorgung abwickelt. An welcher Stelle interessiert das denn den Netzbetreiber?
Zschuckelt: Der Fachbegriff dafür ist Kundenanlage. Nur Photovoltaik, das kannte er. Nicht aber Photovoltaik und BHKW und beide sollen einspeisen, aber nicht voll, sondern nur was nicht vor Ort verbraucht wird. Wir mussten den Fachleuten zeigen, warum das alles so geht und dass das statthaft ist. Auch dass die ganzen Unterzähler oder die Einzelzähler im Netz nicht mehr vom Netzbetreiber gestellt und betrieben werden, sondern dass es wirklich nur noch einen Netzverknüpfungspunkt mit dem Ortsnetz geben wird. Das ist für ihn eine Herausforderung, weil es das erste Mal war.
Müssen Sie den Lastgang der Kundenanlage prognostizieren?
Werner: Wir prognostizieren die Verbräuche, und daraus ergibt sich der Lastgang. Das geht nicht mit Standardlastprofilen.
Hätte sich der Netzbetreiber gegen das Projekt wehren können?
Werner: Rechtlich gesehen darf so eine Kundenanlage nach dem Energiewirtschaftsgesetz für das Gesamtnetz nicht bedeutend sein. Das ist aber nicht genau spezifiziert. Daher muss man das auch mit dem lokalen Netzbetreiber klären. Wir haben dann die Landesenergieregulierungsbehörde in Sachsen-Anhalt kontaktiert. Sie hat uns informiert, dass die Versorgung in diesem Fall als nicht bedeutend für das Gesamtnetz angenommen werden kann. Aber wenn man nicht nur 30 Parteien, sondern 300 hat, dann ist das vielleicht schon wieder anders. Wenn es keine Kundenanlage ist, muss man sich als Netzbetreiber registrieren und hat Auflagen, teils technische, teils andere wie der zur Qualifikation von Mitarbeitern. Das kostet dann.
Welche Umlagen und Abgaben werden denn bei der Konstruktion fällig?
Werner: Die volle EEG-Umlage für den gesamten Strom, die anderen Umlagen für den vom Netz bezogenen Strom, aber keine Stromsteuer. Mehrwertsteuer noch, natürlich.
Viele beschäftigen sich mit Mieterstromprojekten. Oft höre ich, dass das zäh ist.
Zschuckelt: Es ist auch zäh, weil es eine Projektierung erfordert und äußerst viel Know-how. Das ist nicht nur wie einmal die Schlittschuhe anziehen und versuchen, ein bisschen auf dem Eis zu tapsen. Das ist so, wie wenn man die Schlittschuhe anzieht, losfährt und dann noch mit dem Eishockeyschläger vor den Puck haut. Das sind vier Aufgaben auf einmal, mit dem entsprechenden Koordinationsaufwand. Andererseits kann der Mieter 10 bis 15 Prozent seiner Energiekosten sparen, und der Investor kann annehmbare Renditen im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich erzielen. Daher bin ich optimistisch.
Inwiefern hilft es, dass Ihr Projekt relativ groß ist?
Zschuckelt: Hier passt einfach sehr vieles sehr gut zusammen. Es gibt immer noch viele Investoren, die von zweistelligen Renditen und absoluter Sicherheit und Kontrolle träumen. Die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Die Kunden oder Investoren werden sich in Zukunft immer mehr für solche Projekte entscheiden, weil sie die Energiewende vorantreiben. Jetzt muss man die dafür nötigen Kompetenzen aufbauen und dann bei zunehmend sinkenden Kosten im Bereich der dezentralen und digitalen Energiewelt weiterbringen. Das ist die Herausforderung.
Das Gespräch führte Michael Fuhs.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.




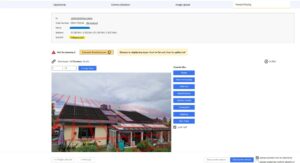


Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass das pv magazine Ihre Daten für die Veröffentlichung Ihres Kommentars verwendet.
Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Spam-Filterung an Dritte weitergegeben oder wenn dies für die technische Wartung der Website notwendig ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist aufgrund anwendbarer Datenschutzbestimmungen gerechtfertigt oder ist die pv magazine gesetzlich dazu verpflichtet.
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Andernfalls werden Ihre Daten gelöscht, wenn das pv magazine Ihre Anfrage bearbeitet oder der Zweck der Datenspeicherung erfüllt ist.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.