Zellrisse und -brüche
Auswirkungen: Zellrisse und -brüche können die Leistung beeinträchtigen. Wenn die Schädigungen schon vor der Leistungsmessung am Ende der Produktion bestanden, hat das zunächst keine Auswirkung, da dann die angegebene Leistung der realen Leistung entspricht. Die Gefahr ist, dass sich die Schädigungen im Laufe der Zeit vergrößern oder erst bilden und später zu Leistungseinbußen führen.
Ursachen: Entstehen die Zellrisse vor der Installation, dann ist unter Umständen ein unachtsames Handling mit den Zellen oder Modulen in der Produktion dafür verantwortlich. Auch während des Transports der Module zum Lager oder auf die Baustelle können durch unsachgemäße Behandlung Risse und Brüche entstehen, genauso wie bei der Installation selbst. Nachdem die Module installiert wurden, können hohe Schnee- oder Windlasten und häufige Temperaturwechsel zu Rissen und Brüchen in den Zellen führen.
Tests: Fallen durch die Risse oder Brüche einzelne Zellregionen oder ganze Zellen aus, zeigt sich dies in der Regel in einer geringeren Leistung. Das lässt sich entsprechend messen und einfach bewerten. Dies gilt vor allem für makroskopische Risse, also Risse, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Allerdings führen die Risse nicht unbedingt sofort zu Leistungseinbußen, besonders bei Mikrorissen. Diese sind mit bloßem Auge nicht erkennbar, sondern zeigen sich erst mit Hilfe einer Elektrolumineszenz(EL)-Aufnahme. Die Interpretation der EL-Bilder ist jedoch nicht ganz einfach.
Risse und Mikrorisse, die sich nicht oder nur geringfügig auf die Leistung eines Moduls auswirken, lassen sich nur schwer bewerten. Die Sorge vieler Betreiber besteht darin, dass sie sich im Laufe der Zeit ausweiten und sich dann zeitverzögert negativ auf die Modulleistung auswirken. Langzeittests in der Klimakammer können hierfür ein Indikator sein, da diese eine künstliche Alterung simulieren sollen. Aber auch in der Klimakammer ist eine Ausweitung der Risse nicht immer mit einem Leistungsverlust verbunden.
Wie widerstandsfähig die Zellen eines Modules unter mechanischer Belastung sind, kann man mit einem mechanischen Belastungstest herausfinden. Dieser ist auch Teil der Norm EN IEC 61730, nach der Module zertifiziert werden. Daraus kann man zum Beispiel ableiten, welchen Wind- oder Schneelasten das Modul voraussichtlich standhalten wird.
Handlungsempfehlung: Ein Solarmodul ohne jeden Riss oder Zellbruch ist eher eine Ausnahme als die Regel. Diese Schädigungen schlagen sich zunächst nicht in der Leistung der Module nieder. Ein Aussage, ob und wie sich die Zellrisse dann weiterentwickeln und was sie für die langfristige Leistung des Moduls bedeuten, kann aufgrund der sehr unterschiedlichen Anwendungen und Bedingungen kaum getroffen werden. Es kann daher nur eine Vereinbarung über „akzeptabel“ oder „nicht akzeptabel“ zwischen Verkäufer und Käufer geben. Es kommt darauf an, das Ausmaß der Risse und Brüche einzugrenzen und vor allem auch eine verlässliche Angabe „ex factory“, also wie die Module die Fabrik verlassen, zu erhalten.
Eine Vereinbarung nützt jedoch nichts, wenn die Daten fehlen. Daher wird die Überprüfung von Serienprodukten mit Elektrolumineszenzaufnahmen innerhalb und am Ende von Produktionslinien immer mehr zu einem Standard, allerdings noch nicht überall. Im Grunde kann nur eine EL-Dokumentation zum Zeitpunkt des Flashens, also kurz vor der Verpackung des Moduls, eine Aussage darüber treffen, ob zum Beispiel Zellbrüche beim Transport oder bei der Produktion entstanden sind.
Käufer von Solarmodulen sollten zunächst darüber nachdenken, an welchem Standort die Module zum Einsatz kommen und welchen Belastungen sie dort vermutlich ausgesetzt sind. Zum Beispiel ist in einer Region, in der nicht viel oder kein Schnee fällt und die Windlasten gering sind, gegebenenfalls eine Zertifizierung im mechanischen Belastungstest für eine hohe Druckbelastung (5.400 Pascal) gar nicht nötig und es reicht, wenn die Module im Test einer geringeren Druckbelastung widerstehen. Des Weiteren sollten Käufer beziehungsweise Installateure darauf achten, dass auch die anderen Komponenten, insbesondere die Unterkonstruktion, der gleichen Beanspruchung standhalten wie die Module. Auch das stabilste Modul nützt nichts, wenn das Montagegestell bei erhöhter Wind- oder Schneelast nachgibt.
Hotspots/Lokale Shunts
Auswirkungen: In Solarmodulen können Hotspots zum einen eine Leistungsminderung bewirken. Zum anderen bergen Hotspots eine potenzielle Brandgefahr. Im schlimmsten Fall erhitzen sie sich so stark, dass die Lamination des Moduls Blasen wirft oder ganz zerstört wird. Dies bedeutet dann eine massive Beeinträchtigung der Anlagensicherheit, denn im Extremfall verschmort die Rückseitenisolation durch die Überhitzung, so dass angrenzendes Material Feuer fangen kann.
Ursachen: Hotspots sind wörtlich übersetzt „heiße Flecken“, also lokale Überhitzungen an einem Solarmodul. Sie entstehen, wenn einzelne Zellregionen oder ganze Solarzellen weniger oder keinen Strom erzeugen und stattdessen Zellvorder- und -rückseite kurzschließen. Der Widerstand dieser mit dem englischen Begriff Shunts genannten Stellen ist hoch, und der Strom, der durch sie fließt, führt zur Erhitzung. Im Betrieb einer Solaranlage kann es zum Beispiel zu Hotspots kommen, wenn einzelne Zellregionen oder ganze Zellen in einem Solarmodul verschattet oder verschmutzt werden. Aber auch in der Produktion der Zellen kann es verschiedene Fehler geben, die zu Hotspots führen. Mögliche Fehlerquellen sind hier zum Beispiel eine schlechte Qualität des verwendeten Siliziums, eine schlechte Lötung oder auch Risse und Mikrorisse, die durch unsachgemäße Handhabung in der Fertigung entstehen.
Tests: Im Labor beziehungsweise in der Produktion kommt man den „heißen Flecken“ zum Beispiel mit dem Hotspot-Test nach der Norm IEC 61215 auf die Spur. Dabei wird ein Modul für eine gewisse Zeit einer hohen Bestrahlung ausgesetzt und die Temperaturentwicklung auf der Modulfläche sowie die Modulkennlinien gemessen. Deuten die Messungen auf Hotspots hin, kann das Modul aussortiert werden. Es gibt auch Hersteller, die damit werben, schon in der Produktion alle einzelnen Zellen auf Hotspots zu untersuchen und betroffene Zellen auszusortieren. Dadurch sollen Hotspot-freie Module garantiert werden. Im Feld, also bei einer bereits installierten Anlage, kann man Hotspots mittels einer Thermografiemessung ausfindig machen. Damit werden überhitzte Stellen an Solarmodulen im Betrieb sichtbar.
Handlungsempfehlung: Betreiber sollten am besten kurze Zeit nach der Inbetriebnahme der Solaranlage eine Thermografieuntersuchung durchführen. Das bietet sich an, weil damit nicht nur Hotspots aufgespürt, sondern auch Installationsfehler gefunden werden können, wie zum Beispiel eine falsche Verschaltung der Module. Es kann auch sinnvoll sein, die Thermografieuntersuchung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Dies gilt insbesondere für Solaranlagen, die auf Gebäuden errichtet wurden, da eine Überhitzung zu einem Gebäudebrand führen kann. Diese Gefahr besteht bei Freiflächenanlagen in der Regel nicht. Ein weiterer guter Zeitpunkt für Thermografieaufnahmen ist kurz vor Ablauf der Produktgewährleistung.
Wenn ein Betreiber Module mit Hotspots in seiner Anlage entdeckt, die nicht auf Verschmutzung oder Verschattung zurückzuführen sind, sollte er die Module am besten austauschen lassen, allein schon um die Brandgefahr einzuschränken. Für diesen Fall sollten im Vorfeld klare Vereinbarungen mit dem Hersteller getroffen werden, wann und unter welchen Bedingungen ein solcher Austausch stattfindet.
Schlechte Lötung
Auswirkungen: Schlecht kontaktierte Zellfinger und Zellverbinder können zu mehreren Problemen führen. Zum einen vermindert sich die Leistung, wenn Zellbereiche oder ganze Zellen wegen mangelnder Kontaktierung inaktiv bleiben. Zum anderen können sich schlecht verlötete Stellen wegen ihres höheren elektrischen Widerstands erhitzen, was wiederum zu einer Blasenbildung oder sogar zu einer Zerstörung des Einbettungsmaterials und der Rückseitenfolie ähnlich wie bei Hotspots führen kann. Das birgt eine Gefahr für die elektrische Sicherheit der Anlage und kann unter Umständen auch einen Brand auslösen.
Ursachen: Schlecht kontaktierte Zellfinger und -verbinder resultieren meist aus Problemen im Lötprozess während der Herstellung. Ungleichmäßige Lötungen, also nicht ganz gerade Linien oder unregelmäßige Stärken, können auf einen manuellen, nichtautomatisierten Lötprozess hinweisen. Dies muss übrigens nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn die Leistung des Moduls dadurch nicht beeinträchtigt wird. Es kann aber für Betreiber, die zum Beispiel eine Dachanlage auf einem Wohnhaus betreiben und Wert auf das optische Erscheinungsbild ihrer Anlage legen, ein Ärgernis sein. Auch bei einer automatischen Lötung können Fehler auftreten, zum Beispiel wenn die optimale Prozesstemperatur verfehlt wird, das Lötmaterial nicht gut geeignet ist oder die Lötbändchen nicht richtig vorbehandelt werden.
Tests: Schlechte Lötverbindungen erkennt man zum Beispiel im Elektrolumineszenzbild. Nicht oder schlecht kontaktierte Zellbereiche erscheinen hier als dunklere Stellen. Im Betrieb können schlechte Lötverbindungen zum Teil auch mit einer Thermografiemessung entdeckt werden, da an schlechten Kontaktierungen der elektrische Widerstand und damit auch die Temperatur ansteigt. Aus Tests auf Alterungsbeständigkeit kann man ableiten, wie sich die Lötverbindungen im Laufe der Betriebsdauer einer Solaranlage verhalten. Sowohl im mechanischen Belastungstest als auch im Temperaturwechsel- und Feuchte-Wärme-Test können sich Lötbändchen aufgrund von mechanischem Stress beziehungsweise chemischen Prozessen lösen.
Handlungsempfehlung: Käufer sollten hier mit den Herstellern klare Vereinbarungen zum allgemeinen Erscheinungsbild der Lötbändchen treffen. Wenn Hersteller die Lötung verbessern wollen, zeigt die Erfahrung, dass einige Probleme durch eine Umstellung von einer manuellen auf eine automatisierte Lötung gelöst werden können. Auch eine bessere Material- und Prozesskontrolle bei der automatischen Lötung kann unter Umständen Abhilfe schaffen.
Schlechte Verkapselung/Laminierung
Auswirkungen: Eine schlechte Verkapselung beziehungsweise Einbettung der Solarzellen gilt als eines der größten Risiken für die Lebensdauer der Module. Sie kann zur Folge haben, dass Feuchtigkeit in das Modul eindringt, Zellen angegriffen werden und Lötbändchen korrodieren, so dass Module teilweise oder ganz ausfallen. Außerdem besteht eine erhöhte Gefahr, dass die elektrische Sicherheit des Moduls herabgesetzt wird oder eine Leistungsminderung durch PID-Effekte auftritt. Wird im Prozess Feuchtigkeit oder Luft mit einlaminiert, kann es später zu Blasenbildung kommen. Ist die Zusammensetzung der Folie nicht optimal, kann sich die Folie im Laufe der Zeit gelblich verfärben, was aber eher optische Probleme mit sich bringt.
Ebenfalls ein vermutlich rein optisches Problem, das wahrscheinlich auf die Einbettungsmaterialien zurückzuführen ist, sind sogenannte Schneckenspuren. Diese gaben Experte lange Zeit Rätsel auf, weil nicht klar war, wodurch sie ausgelöst werden und welche Auswirkungen sie auf die Modulleistung haben. Mittlerweile scheint dieses Rätsel weitgehend gelöst. Untersuchungen von Fraunhofer CSP, Fraunhofer ISE und dem Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) legen nahe, dass die dunklen Verfärbungen auf Silberpartikel zurückzuführen sind, die sich in der EVA-Folie angereichert haben. Ursache ist wohl eine ungünstige Kombination von Einkapselungsmaterial und Rückseitenfolie und den entsprechend zugemischten Additiven. Gelangt Feuchtigkeit ins Modul, diffundieren die Additive durch Mikrorisse oder die Zellkanten zur Vorderseite der Zellen und reduzieren dort Silberionen zu metallischem Silber. Dies ist dann für die Verfärbung verantwortlich, so die derzeitige These der Wissenschaftler.
Ursachen: Die Ursachen für eine fehlerhafte Einbettung sind in der Regel im Produktionsprozess zu suchen, einerseits beim verwendeten Material, zum Beispiel der EVA-Folie, und andererseits bei Problemen im sehr temperatur- und zeitkritischen Laminierungsprozess selbst. Probleme können auch dadurch auftreten, dass andere EVA-Folien benutzt werden als in der Zertifizierung und den Klimakammertests. Durch eine Änderung der Komponenten, der Bill of Materials (BOM), ist dann auch die Zertifizierung eines Moduls fraglich. Bei der Lamination vernetzen die Polymerfäden in dem EVA-Kunststoff.
Tests: Die Güte der Verkapselung testet man unter anderem mit dem Feuchte-Wärme-Test in der Klimakammer. Nach der Belastung zeigt die Leistungsmessung, wie stark das Modul degradiert ist. Treten hier außerdem Blasen oder Leistungsminderungen auf, ist das ein Indikator dafür, dass mit den Jahren auch im Betrieb Probleme auftreten können. Die Qualität der Vernetzung lässt sich mit einem EVA-Vernetzungstest oder mit einem Rip-off-Test prüfen.
Handlungsempfehlung: Um zu gewährleisten, dass in den gekauften Modulen auch die gleiche Folie verwendet wird wie bei der Zertifizierung des Moduls, sollten Käufer im Idealfall Produktionsaudits durchführen oder während der Produktion der bestellten Charge vor Ort sein, um einen Blick auf die Materialien und Prozesse zu werfen. Nur so kann man kontrollieren, dass die verwendete Bill of Materials auch wirklich mit dem bestellten Produkt identisch ist.
Käufer sollten außerdem mit dem Hersteller die genaue Bill of Materials vereinbaren und klären, welche Ausgleichsmaßnahmen bei Abweichungen getroffen werden können. Dafür ist es natürlich auch nötig, dass Hersteller die gegebenenfalls unterschiedlichen Materiallisten verschiedener Produktchargen ihren Kunden offen kommunizieren.
Beim Kauf größerer Modulmengen können auch eigene Vernetzungs- und Ripp-off-Tests durchgeführt werden. Dann sollte mit dem Hersteller klar vereinbart werden, bei welchem Vernetzungsgrad beziehungsweise welcher Abzugskraft welche Kompensation stattfindet. Diese kann finanziell sein. Wenn das Ergebnis allerdings zu schlecht ist, sollten neue Module geliefert werden.
Neben lange bekannten Materialien für EVA und Backsheet sind in den vergangenen Jahren viele neue Produkte auf den Markt gekommen, die natürlich noch nicht über langjährige Referenzen aus dem Betrieb in Photovoltaikanlagen verfügen. Sie müssen daher erst einmal über Testverfahren geprüft werden, die eine Langzeitstabilität abbilden können. Werden die Zertifizierungen richtig gemacht und dann auch in der Produktion nachgehalten, gibt dies einen Anhaltspunkt auf die Eignung von Materialien und Verfahren. Die Schnelltests können die Prüfung auf Langzeitstabilität nicht abbilden, weshalb für eine exakte Bewertung die enthaltenen Materialien vorher geprüft sein müssen.
Defekte Anschlussdosen
Auswirkungen: Die Anschlussdosen stellen die elektrische Verbindung des Moduls mit der Anlage her und enthalten die Bypassdioden, die die Module vor der Auswirkung von Verschattungen und vor Überspannung infolge eines Blitzschlages schützen. Probleme mit den Anschlussdosen gibt es überwiegend aus zwei Gründen: Entweder lösen sich die Dosen vom Modul und werden undicht oder die Bypassdioden in der Dose werden überlastet und fallen aus.
Bei auf Dächern installierten Modulen sind Probleme mit den Anschlussdosen besonders ärgerlich, weil sie dort wesentlich schlechter zu erreichen sind und man die Module erst vom Montagegestell abmontieren muss. Bei manchen Anschlussdosen können die Bypassdioden ausgetauscht werden, andere sind vergossen, so dass das nicht geht. Es gibt auch Anschlussdosen, die noch mehr Elektronik enthalten, zum Beispiel sogenannte Power Optimizer (Leistungsoptimierer). Dort können die Fehlerbilder andere sein.
Ursachen: Dass sich Anschlussdosen vom Modul lösen, ist in der Vergangenheit auch bei namhaften Herstellern vorgekommen. Der Grund dafür liegt meist in einem ungeeigneten Klebstoff, der nicht über die Betriebsdauer der Anlage durchhält. Wenn die Dioden eines Modultyps häufig überlastet werden, sind sie für den gewählten Anwendungsbereich vermutlich zu klein dimensioniert. Unter Umständen werden sie bei dauerhaft oder regelmäßig verschatteten Anlagenteilen stark beansprucht, und genau dafür müssen die Dioden auch ausgelegt sein.
Tests: Ob eine erhöhte Gefahr besteht, dass sich die Anschlussdosen mit der Zeit vom Modul ablösen, kann man unter anderem mit den Tests in der Klimakammer prüfen. Ein anschließender Wet-Leakage-Test (Prüfung des Isolationswiderstands bei Benässung) zeigt dann, ob die Dose auch nach einer beschleunigten Alterung noch sicher und luftdicht am Modul befestigt ist. Hersteller sollten auf eine dauerhaft gute Qualität des verwendeten Klebstoffs beziehungsweise des Laminierprozesses und eine angemessene Dimensionierung der eingebauten Dioden achten.
Potenzialinduzierte Degradation
Auswirkungen: Potenzialinduzierte Degradation (PID) ist erst seit einigen Jahren ein größeres Thema für kristalline Solarmodule. Wenn Module davon betroffen sind, bricht ihre Leistung um bis zu 80 Prozent ein. In der Praxis wird der Effekt bisher allerdings noch nicht oft beobachtet. Er tritt umso schneller ein, je feuchter und wärmer eine Umgebung ist. Ob er eintritt, hängt vom Aufbau des Moduls und der elektrischen Verschaltung ab. Der Effekt ist oft reversibel.
Ursachen: Zu dieser Degradation kommt es, wenn Kriechströme zwischen geerdeten Modulrahmen und dem negativen Pol des Moduls durch das Glas hindurchfließen. Das kann zum Beispiel in den Morgenstunden der Fall sein, wenn Tau auf den Modulen liegt und gleichzeitig die Sonne scheint. Zu den Kriechströmen kann es nur kommen, wenn ein großes elektrisches Potenzial zwischen dem Minuspol des Moduls und dem Modulrahmen besteht. Wenn der Minuspol geerdet werden kann, was vom Wechselrichter abhängt, tritt der Effekt nicht auf. Vom Modulmaterial hängt ab, ob die Kriechströme zu Schädigungen führen.
Tests: Um Module auf PID zu testen, gibt es spezielle PID-Tests (siehe Kapitel 5, Seite 49).
Handlungsempfehlung: Viele Modulhersteller bieten inzwischen Module an, die „PID-frei“ sind und bei denen das auch von Prüflaboren bestätigt wurde. Das bedeutet aber nur, dass sie einen der Tests bestanden haben, die aber nicht standardisiert sind. Daher sollten Käufer von sogenannten PID-freien oder PID-resistenten Modulen immer darauf achten, in welchem Labor der Test unter welchen Bedingungen durchgeführt wurde. Außerdem ist wichtig zu kontrollieren, dass die Bill of Materials der gelieferten Module die gleiche ist wie die, unter der der PID-Test stattfand.
Da viele Experten an der Qualität der PID-Tests mancher Labors zweifeln, bietet sich bei größeren Bestellungen an, eigene PID-Tests durchzuführen. Dazu ist es wichtig, dass man mit dem Hersteller klar vereinbart, wie diese Tests durchgeführt werden und bei welchem Ergebnis welche Kompensation stattfindet.
Ist der PID-Test wider Erwarten positiv, kann zum Beispiel gleich eine Box zwischen Wechselrichter und Module geschaltet werden, die die Module nachts unter eine kleine Spannung setzt. Das stoppt die Degeneration. Tritt PID in einer bereits installierten Anlage auf, kann der Effekt ebenfalls mittels solch einer Box rückgängig gemacht oder zumindest gemildert werden.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.




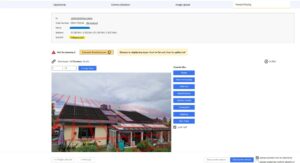


Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass das pv magazine Ihre Daten für die Veröffentlichung Ihres Kommentars verwendet.
Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Spam-Filterung an Dritte weitergegeben oder wenn dies für die technische Wartung der Website notwendig ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist aufgrund anwendbarer Datenschutzbestimmungen gerechtfertigt oder ist die pv magazine gesetzlich dazu verpflichtet.
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Andernfalls werden Ihre Daten gelöscht, wenn das pv magazine Ihre Anfrage bearbeitet oder der Zweck der Datenspeicherung erfüllt ist.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.