Ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Forschungsteam der Universität des Saarlandes, der Zeppelin Universität und dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat den Wegweiser „Der Weg zum Klimabürger“ veröffentlicht.
Die Broschüre soll kommunale Klimaakteure dabei unterstützen gemeinsam mit Bürgern Klimaschutzprojekte zu verwirklichen. Somit können die Bewohner die Energiewende vor Ort aktiv mitgestalten, wie die Herausgeber des Wegweisers am Dienstag mitteilten. Das Engagement der Bürger trägt demzufolge entscheidend zur Akzeptanz und zum Erfolg der Energiewende in ihrem Heimatort bei. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) sieht sich durch die Ergebnisse der Förderinitiative bestätigt: „Die Forschungsprojekte haben gezeigt, wie wichtig die Einbindung der Bürger und Bürgerinnen für das Gelingen der Energiewende ist.“
Wie eine kreative Bürgerbeteiligung gelingen kann, wird anhand von acht Strategien in dem Wegweiser beschrieben. In der Broschüre lassen sich ebenfalls Anregungen finden, um Herausforderungen wie Widerständen oder Desinteresse der Bürger an erneuerbaren Energien zu begegnen. „Wir zeigen mit zahlreichen Praxisbeispielen, auf welche Weise Städte und Gemeinden bereits erfolgreich Bürgerbeteiligung für Klimaschutz und Energiewende umgesetzt haben. Eine Nachahmung ist ausdrücklich erwünscht“, erklärte Wissenschaftlerin Ria Müller vom IÖW.
Neue Anspracheformen wie die Veranstaltung “Tag der offenen Heizungskeller” der Gemeinde Nalbach können das Interesse der Bürger für Themen der Energiewende wecken. Soziale Normen spielen eine Rolle. So kann eine Photovoltaik-Dachanlage Nachbarn dazu animieren dem Vorbild zu folgen und somit Nachahmer anlocken.
Durch Investitionen in Erneuerbare-Energie-Anlagen produzieren Bürger auf dem eigenen Dach Strom und Wärme. Dieses Potenzial wird der Broschüre zufolge allerdings oft noch nicht genügend ausgeschöpft, wie ein Beispiel aus dem Kreis Steinfurt zeigt. Dort würden nur zehn Prozent der geeigneten Dachflächen bislang für PV-Anlagen genutzt.
Eine weitere Möglichkeit zur Teilhabe seien auch Bürgersolarparks und -windparks. Diese Gemeinschaftsenergieanlagen ermöglichten Bürgern auch mit relativ kleinen Beträgen eine finanzielle Teilhabe an der Energiewende. Nach der Studie sind Menschen besonders zugänglich für erneuerbare Energien oder Ökostrom-Angebote, wenn sie eine neue Wohnung beziehen oder sich ein neues Haus kauften.
Wenn Bürger sich an kommunalen Energieprojekten beteiligen, könnten sie eigene Ideen und Erfahrungen einbringen. Durch die Zusammenarbeit mit Vereinen und Initiativen lassen sich daher neue Kreise für Klimaschutz und die Energiewende gewinnen, wie es weiter hieß. Um eine Vernetzung zu erzielen, sei es nötig Strukturen zu schaffen und einen regelmäßigen Austausch zwischen allen Energieakteuren und potenziell Interessierten in der Region zu initiieren. Das Zusammenspiel von Verwaltung, Wissenschaft, Unternehmen und Zivilgesellschaft könne genutzt werden, um deren Wissen zu vereinen und die unterschiedlichen Perspektiven in die Energieprojekte einfließen zu lassen.
Die Broschüre„Der Weg zum Klimabürger“ steht hier zum Download bereit. Die acht Strategien finden Sie unter Punkt 5. (Sabine Meier)
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.





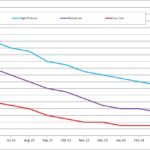
Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass das pv magazine Ihre Daten für die Veröffentlichung Ihres Kommentars verwendet.
Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Spam-Filterung an Dritte weitergegeben oder wenn dies für die technische Wartung der Website notwendig ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist aufgrund anwendbarer Datenschutzbestimmungen gerechtfertigt oder ist die pv magazine gesetzlich dazu verpflichtet.
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Andernfalls werden Ihre Daten gelöscht, wenn das pv magazine Ihre Anfrage bearbeitet oder der Zweck der Datenspeicherung erfüllt ist.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.